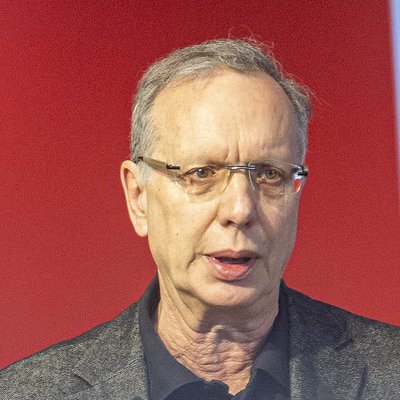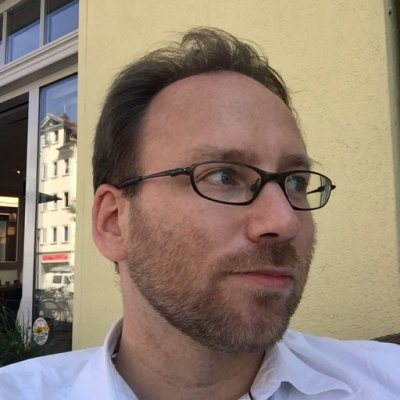Probleme, Prinzipen und mögliche Praxen linker Außenpolitik in der multipolaren Welt
- imago stock&people
Hoffnung nach dem Kalten Krieg: Abrüstung, Kooperation, gemeinsame Sicherheit
Das Ende des Kalten Kriegs eröffnete 1985-1990 die Möglichkeit für ein Ende des Wettrüstens und der atomaren Bedrohung. In Europa schien eine neue Friedensordnung im Geiste des KSZE-Prozesses und der Helsinki-Schlussakte eine reale Perspektive. Abrüstung, Kooperation und eine gemeinsame Hinwendung zu den drängenden globalen Problemen waren die Hoffnung, ebenso eine freiere und selbstbestimmtere Entwicklung aller Staaten, die häufig zum Ort von Stellvertreterkriegen gemacht oder als Teil von Einflusssphären diszipliniert wurden.
Diese Hoffnungen wurden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zunichte gemacht. Der Jugoslawienkrieg markierte in dieser Hinsicht einen Einschnitt. Die beschleunigte neoliberale Globalisierung ab 1990 stand für Umweltzerstörung, Neokolonialismus und Zerstörung von Arbeitsplätzen durch einen ungezügelten Finanzkapitalismus.
Anstelle globaler Kooperation entwickelte sich eine unipolare Weltordnung, in der die USA als einzig verbliebene militärische und ökonomische Supermacht ihre Interessen weltweit mit Druck, Intervention und Krieg durchsetzen konnten. All diese Erfahrungen flossen in die Gründung der Partei Die Linke ein und prägten das Erfurter Grundsatzprogramm.
Neue Machtverschiebungen: China, USA, EU und Russland
Inzwischen sind andere, zusätzliche Erfahrungen in den Vordergrund getreten. China konnte die veränderte globale Arbeitsteilung für sich nutzen und stieg zur zweiten Macht neben den USA auf. Die USA koppeln sich in puncto Beistandsversprechen zunehmend von Europa ab und priorisieren ihre Interessen und priorisieren ihre Interessen auf das nähere Umfeld, auf Lateinamerika, Grönland und den Pazifik. Zwischen der EU und Russland ist eine neue, militärisch gefährliche Konfliktlinie entstanden. Weltweit konnten ehemalige Schwellenländer von der Vertiefung des Welthandels profitieren und suchen ihre Position zwischen Multilateralismus, neuen Bündnissen und eigenen Dominanzansprüchen. Eine enge Folge von Krisen hat die Grenzen der neoliberalen Ordnung verdeutlicht: die Finanzkrise 2007-2009, die Eurokrise 2011-2012, die militärischen Krisen in der Ukraine 2014 und um den Aufstieg des Islamischen Staates 2013-2019, die Covid-19-Krise 2020-2022, die Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Eine neue, stabile Weltordnung ist derzeit nicht zu erkennen.
Die marktliberale Globalisierung war in den 1970er-Jahren politisch angestoßen worden, um die Wachstumsschwäche der westlichen und allen voran der US-Ökonomie zu überwinden. Neue Regeln und Normen wurden mittels bestehender und neu geschaffener Institutionen, wie dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation, erlassen – nicht nur um neue Exportmärkte zu schaffen, sondern auch um weltweit produzieren zu können. Westliche Konzerne wollten im Weltmaßstab von unterschiedlichen Lohnniveaus profitieren und der gewerkschaftlichen Offensive ihrer Zeit entziehen.
Ungleiche Integration und der Aufstieg Chinas
Das Ergebnis war eine rapide Expansion des Weltmarktes und eine Revitalisierung des Wirtschaftswachstums in den westlichen Ökonomien – und schließlich schied die UdSSR aus der machtpolitischen Konkurrenz aus. Während die Lohnarbeitenden auf den Werkbänken der Welt ausgebeutet wurden, gelang es aber insbesondere in Ostasien, die Kontrolle über die Bedingungen der zunächst untergeordneten Integration in den Weltmarkt zu behalten und selbst den lokalen Industrialisierungsprozess zu gestalten: China ist heute zugleich Werkbank für globale Konzerne, eigenständiger Exporteur, Hightech-Konkurrent globaler Konzerne, Konsument globaler Produktion, Anlageort für Ausländische Direktinvestitionen und Exporteur eigener Direktinvestitionen. China ist die Sprossen der globalen Arbeitsteilung emporgeklettert und versucht die Grenzen seines lokalen Marktes durch eigene Projekte (z.B. Belt and Road; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)) zu überwinden, sowie die bestehenden Institutionen der Globalisierung im eigenen Interesse zu nutzen und zu gestalten, indem es sich zum Garanten der multilateralen Ordnung erklärt.
Geoökonomische Konkurrenz und Fragmentierung der Globalisierung
Es sind mehrere Pole im Weltsystem entstanden, von denen die USA und China derzeit ökonomisch am bedeutsamsten sind und offen um Einfluss und direkte Macht ringen.
Die USA konnten jahrzehntelang auf Grund ihrer stark finanzialisierten Ökonomie und der Sonderrolle des Dollars als Leitwährung vom Globalisierungsprozess profitieren. Ihre global agierenden Konzerne, deren Vormachtstellung in transnationalen Lieferketten sowie die Patentstrukturen und Regeln zum geistigen Eigentum sichern einen exklusiven Teil am weltweit erwirtschafteten Mehrprodukt. Zur Aufrechterhaltung dieser hegemonialen Struktur nahmen sie auf zahlreichen Feldern ihre eigene Deindustrialisierung in Kauf. Heute erleben sie die Verlagerung von Produktionskapazitäten als geoökonomisches Problem. Der Aufbau materieller und immaterieller chinesischer Infrastrukturen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, stellt sich für sie zudem als geopolitische Herausforderung dar. Jene Elemente der Globalisierung, die die Industrialisierung und das industrielle Upgrading Chinas begünstigen, sollen durch Zölle, Exportbeschränkungen und Investitionskontrollen eingehegt werden, diese Politik wird auch von der EU, aber vor allem den USA unter Trump betrieben. Wir erleben gegenwärtig eine einschneidende Veränderung in der Globalisierung:
Hatte der Staat bislang die Funktion, Hindernisse für das freie Wirken der Marktkräfte zu beseitigen („marktkonforme Demokratie“ – Angela Merkel), greift der Staat nun in die Ökonomie ein, um geopolitische Macht zu erhöhen und die Akkumulation und Profitabilität des nationalen Kapitals zu erhöhen.
Diese gewachsene Rolle der Geoökonomie bedeutet nicht das Ende der Globalisierung, sondern ihre Fragmentierung in Einflusssphären. Bislang können nur die beiden größten Mächte dabei eigenständige ökonomische Teilsysteme und Einflusszonen mit eigenen Regeln und Normen um sich herum herausbilden.
Diese Tendenz der geoökonomischen Fragmentierung und die Praxis der Trump-Administration, bilaterale Verhandlungsformate zu erzwingen, schwächt die Möglichkeiten der Einflussnahme kleinerer und mittlerer Staaten auf die Gestaltung der bis dato multilateral verhandelten Welthandelsordnung: Der Multilateralismus von Institutionen, wie der WTO, war zwar von Führungsinteressen der USA geprägt, basierte jedoch weit mehr als der neue US-Bilateralismus auf hegemonialen Konzessionen.Und es galt insbesondere für die EU: Als Staatenunion und wirtschaftliches Integrationsprojekt konnte sie global in der multilateral verhandelten Handelsordnung ihr höchstes Gewicht entfalten und erhebliche Teile der wirtschaftlichen Interdependenzen politisch gestalten.
Beinahe spiegelbildlich dazu hat auf dem Feld der Sicherheitspolitik die brüchige Hegemonie der USA dazu geführt, dass regionale Mächte nun einfacher geopolitisch Einfluss nehmen können - auch durch Angriffskriege. Die Dialektik dieser Entwicklung verdichtet sich exemplarisch nicht nur in den Angriffskriegen der Türkei, die derweil ihre handelspolitische Gestaltungsmacht schon lange in Gestalt der Zollunion mit der EU aufgegeben hat, sondern noch prägnanter im russischen Krieg gegen die Ukraine: Die vereinbarte Assoziierung der Ukraine mit der EU gefährdete Russlands ökonomisches Integrationsprojekt der Eurasischen Union – mit der Ukraine fehlte damit die wichtigste Teilhaberin. Russland griff 2014 zu militärischen Mitteln und begann 2022 mit der Invasion des Landes.
Multipolare Konkurrenz ersetzt unipolare Ordnung
Diese neuen Formen der Konkurrenz signalisieren, dass wir die unipolare Ordnung bereits verlassen haben und in eine Periode multipolarer Konkurrenz mit schwindenden allseits anerkannten Konfliktregelungskapazitäten eingetreten sind. Deswegen steht linke Außenpolitik heute vor gewachsenen Herausforderungen: Die sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme der alten Weltordnung verlangen noch immer nach Lösungen, ja haben sich zum Teil verschärft, aber die Bedingungen ihrer gemeinsamen Lösung haben sich massiv verschlechtert. Denn Multipolarität allein bedingt noch keinen Multilateralismus. Es ist erforderlich, unsere heutige von multipolarer Konkurrenz geprägte Ordnung in eine zu überführen, die auf multilateraler Zusammenarbeit basiert. Auch Europa muss strategische Unabhängigkeit gewinnen und seine Rolle in der Welt neu definieren, auch die neue US-Sicherheitsstrategie zwingt uns dazu.
Aus linker Sicht können wir aber eine strategische Unabhängigkeit der EU nicht als Militarisierung der europäischen Außenpolitik und Aufrüstung auffassen.
Europas derzeitige Aufrüstung soll den USA ermöglichen, ihre Bündnisverpflichtungen gegenüber Europa schrittweise zu reduzieren und sich stattdessen auf die Konkurrenz mit China zu konzentrieren. Europäische Souveränität heißt, die Bedingungen für eine eigenständige europäische und in ihr deutsche Außenpolitik zu schaffen, die gerade nicht die Muster von Machtpolitik reproduziert, die die herrschende multipolare Konkurrenz prägen. Innere Struktur und Außenverhalten der EU bedingen dabei einander. Dies ist eine große Herausforderung für linke Programmatik und eröffnet die Frage einer weiteren Vertiefung der europäischen Integration, die zugleich mit ihrem herrschenden Integrationsmodus bricht und Konzerninteressen herausfordert.
Ohne Überwindung der herrschenden neoliberalen Integrationsweise, die die Mitglieder der EU als nationale Wettbewerbsstaaten zueinander in Konkurrenz setzt, wird dies nicht gelingen. Bis zur gegenwärtigen Krise des Exportmodells konnten die stärksten Mitgliedstaaten der Union die schwächeren als innere Peripherie nutzen und so über Sondervorteile in der Weltmarkkonkurrenz verfügen, ohne deren Kosten angemessen zu tragen. Über Jahrzehnte prägte die Beseitigung von Markteintrittsbarrieren den Kurs der europäischen Integration, in der Eurokrise zeigte dieser Modus erste Schwächen. Inzwischen ist er erlahmt. In Gestalt des Just Transition Fonds oder des Kohäsionsfonds gibt es bereits heute Ansätze jenseits eines reinen Marktliberalismus.
Die Zukunft der EU hängt davon ab, einen Rahmen für eine solidarische EU zu schaffen, die auf starken inneren Transfermechanismen basiert.
Ohne diesen gibt es keine Kapazität für europäische Industriepolitiken, die uns befähigen, der Abhängigkeit von den USA zu entkommen. Der 2025er-USA-EU-Handelsdeal zementiert europäische Abhängigkeiten und schafft neue. Er folgt dem Betreiben der autoritären Trump-Administration, die Unterordnung der EU unter US-Interessen im Kontext eines insgesamt schwindenden Einflusses der USA zu forcieren. Damit die EU im Weltsystem eine ausgleichende und dem internationalen Recht verpflichtete Rolle spielen kann, muss sie Antworten auf Fragen ihrer Energiesouveränität, ihrer digitalen und sicherheitspolitischen Souveränität finden. Die Reduzierung einseitiger Abhängigkeiten von Rohstoffen und Technologien gegenüber den USA und China kann dabei nicht in Form eines Handelskrieges oder konfliktiven Decoupling, sondern nur im Sinne einer Diversifikation von Risiken erfolgen.
Eine demokratisch-sozialistische und strategisch unabhängige EU hat die Kapazität, sich von der Konfrontationspolitik der USA gegenüber China zu emanzipieren und eine aktive partnerschaftlich-solidarische Politik gegenüber den Ländern des globalen Südes zu verfolgen, sowie ein konstruktives Verhältnis zu anderen Staaten mittlerer Stärke und den BRICS zu pflegen. Dazu ist nach gemeinsamen Interessen bei der Erneuerung und Reform bestehender multilateraler Institutionen, wie der WTO, zu suchen. Leitlinie für die Entwicklung eines neuen (nicht von den Interessen des globalen Nordens bestimmten) Regelwerks sollte sein, dass damit die gemeinsame Zielbestimmung wirksam verfolgt werden kann, die mit den „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen vereinbart wurde.
Primat des Zivilen – Praxen und Institutionen eines zivilen Multilateralismus
Die Multipolarisierung der Welt, der Rechtsruck in zahlreichen Staaten, offen artikulierte Territorialansprüche gegenüber Dritten oder laufende Angriffskriege wie gegen die Ukraine haben in unserer und in vielen anderen Gesellschaften dem Bedürfnis nach Sicherheit vor Krieg und Angriffen einen neuen Stellenwert gegeben. Die nach der Invasion der Ukraine angestoßene „Zeitwende“ nutzt dieses gesellschaftliche Bedürfnis nach Sicherheit, um einen Aufrüstungs- und Militarisierungsprozess anzustoßen, bei dem unsere Sicherheit entgrenzt und zur Unsicherheit der anderen wird.
Demgegenüber fußt linke Sicherheitspolitik auf einem Primat des Zivilen, der die tieferen/strukturellen Ursachen von Kriegen, Gewalt und Unsicherheit angeht und in Richtung Abrüstung und Frieden strebt.
Die Akzeptanz dafür, Interessen gewaltsam durchzusetzen und Konflikte mit militärischen Mitteln zu lösen, ist gegenwärtig eng mit wachsender Polarisierung und der Wirkungslosigkeit institutionalisierter Konfliktbearbeitung verbunden. Die Erzählung, wir befänden uns in einer Art Endkampf zwischen einem demokratischen und autoritären Staatenblock, wird nicht nur der Komplexität der Welt nicht gerecht, sondern verschleiert hinter Konflikten liegende Interessen und befördert Polarisierung.
Genauso wenig angemessen ist die konkurrierende Deutung, demnach (fast) alle militärischen Konflikte Ausdruck eines postkolonialen Widerstandskampfes gegen westliche Dominanz seien. Diese Denkmuster zur Legitimierung von Kriegen müssen politisch aufgelöst werden, damit Militarisierung nicht die Oberhand behält.
Wenig deutet daraufhin, dass sich im Weltsystem auf absehbare Zeit ein gemeinsam geteiltes Verständnis von Demokratie entwickeln wird, das Voraussetzung für einen Multilateralismus sein kann. Dieser kann sich aber stützen auf das, was global gemeinsam an Werten, Zielen, Institutionen, Regeln, Vertragswerken und Beschlüssen entwickelt und kodifiziert wurde: Die Erklärungen zu humanitären, sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Menschenrechten sowie zu Völkerrecht und Souveränitätsrechten; die globalen Vertragswerke zu Klima, Nachhaltigkeit, Entwicklung; die Anforderungen an eine gerechtere und faire Wirtschaftsordnung; die entsprechenden Agenden und Institutionen. Global durchgesetzt werden kann nur, was global vereinbart ist.
Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu Regime-Change-Politiken und Neoimperialismen.
Deswegen streben wir nicht nur eine strategisch unabhängige EU an, die sich der Unterordnung unter die Interessen der USA verweigert und eine ausgleichende Politik im Weltsystem verfolgt. Statt geoökonomischer Konfrontation treten wir für eine faire Weltwirtschafts- und Handelsordnung ein.
Die Vereinten Nationen stärken und reformieren
Das Eintreten für eine multilaterale Ordnung als politischer Rahmen der Verflechtung ist untrennbar mit dem Eintreten für die sie tragenden Institutionen verbunden. Die Charta der UN begründet wesentlich unsere Völkerrechtsordnung. Jedoch gilt es, das System der UN im emanzipatorischen Sinne weit stärker als Handels-, Finanz- und Entwicklungssystem sowie als System zur globalen Daseinsvorsorge zu begreifen und in diese Richtung weiterzuentwickeln. Daher sind multilaterale Abkommen immer bilateralen Verträgen vorzuziehen.
Perspektivisch ist unilaterale Entwicklungshilfe durch Beteiligung an UN-Fonds und multilateralen Ausgleichsystemen zu ersetzen. Sie müssen insbesondere im Bereich der Klimapolitik, der Klimaanpassung und Kompensation für Klimaschäden erheblich ausgebaut werden. Perspektivisch soll die UN-Finanzierung durch eigene Steuereinnahmen ergänzt und unabhängiger werden.
Damit die UN effektiv und glaubhaft als Rahmen einer multilateralen Ordnung dienen können, ist die Reform des UN-Sicherheitsrates hin zu einer angemessenen Repräsentanz der Weltregionen sowie eine Abschaffung oder Einschränkung des Vetorechtes seiner ständigen Mitglieder unumgänglich. Anstelle der Dominanz durch die ständigen Mitglieder, die zugleich das System der UN an sich unterhöhlt, muss eine Vertiefung multilateraler Praxen des UN-Systems treten. Diese erfordern nicht zuletzt eine Stärkung der Kompetenzen der UN-Vollversammlung gegenüber dem Sicherheitsrat. Dazu müssen sich die EU und die Bundesrepublik aktiv um globale Koalitionen und Mehrheiten bemühen, die die globalen Herausforderungen, wie Klima, Nachhaltigkeit, Armut und Entwicklung gemeinsam als Menschheitsaufgaben bearbeiten und die UN weiter entwickeln wollen. Dazu ist von unserer Seite die Bereitschaft zum fairen Interessensausgleich erforderlich – ob in Wirtschafts-, Handels-, oder Klimapolitik. Einsatz für globale Gerechtigkeit ist um ihrer selbst willen, aber auch als Schlüssel für globale Mehrheiten geboten. Das erfordert nicht nur ein konstruktives Verhältnis zu den BRICS-Ländern, sondern ebenso zur G-77-Gruppe sowie den Inselstaaten (SIDS) – je mehr diplomatische Optionen sie haben, desto besser können sie ihre Souveränität realisieren.
Eine Reduktion von Außenpolitik auf Machtpolitik treibt nicht nur Interventionismus an, sondern führt zuweilen zu einem selektiven Interesse an Konflikten. Dieses „Vergessen“ von machtpolitisch scheinbar irrelevanten Konflikten wird weder humanitären Standards gerecht, noch ist es mit dem Gebot friedenspolitischer Vernunft vereinbar: Das System der UN beschränkt sich auch deswegen nicht nur auf zwischenstaatliche Beziehungen, sondern stellt auch Kapazitäten für zivile Konfliktbearbeitung innerhalb von Staaten bereit. Dazu gehört auch Transitional Justice. Diese Aufgaben verlieren nicht an Bedeutung, nur weil innerhalb der multipolaren Ordnung wieder verstärkt zwischenstaatliche Kriege geführt werden oder drohen. Die Mehrzahl aller Kriege war und ist innerstaatlich – ein Ende dieser Tatsache ist nicht absehbar und die Übergänge zu zwischenstaatlichen Kriegen sind fließend.
Die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen in Gestalt des Systems der Vereinten Nationen ist ein Prozess, der nicht auf der Ebene der Staatenbeziehungen und der Bearbeitung bewaffneter Konflikte stehengeblieben ist. Sie strahlt trotz Blockaden und Rückschlägen auf die normativen Fundamente globaler Menschenrechte aus.
Auch deswegen ist es heute möglich, die Frage von Frauen- und LGBTIQ-Rechten auf internationaler Ebene zu stellen. Feministischen Außenpolitik wurde leider zu einem Schlagwort reduziert und droht wieder aus dem Korpus herrschender Politik verdrängt zu werden. Doch das bereits Erreichte geht über Schlagworte hinaus – sei es die Frauenrechtskonvention von 1979 (CEDAW) oder die Women, Peace and Security“ (WPS)-Agenda von 2000, die auf der UN-Sicherheitsratsresolution 1325 basiert und die Rolle von Frauen in Friedens- und Sicherheitsprozessen stärkt.
Dennoch ist auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, dass es zu einer grundlegenden Reform der UN kommt. Insbesondere dort, wo sie die Machtpotenziale der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat schwächen würde, besteht für die meisten anderen Staaten wenig Handhabe, sie durchzusetzen. Angesichts der Ernüchterung über herrschende staatliche Politiken darf nicht vergessen werden, dass die Impulse zur Weiterentwicklung progressiver Politiken auf internationaler Ebene häufig gar nicht von Regierungen ausgegangen sind.
Die Parteien und Bewegungen der politischen Linken arbeiten über die Grenzen von Nationalstaaten hinaus zusammen. In diesem Sinne antizipierte ihr Internationalismus schon vor weit über hundert Jahren eine Form globaler Zivilgesellschaft. Die Zusammenarbeit d(D)er Linken mit widerständigen emanzipatorischen Bewegungen und die Vernetzung innerhalb der linken Parteienfamilie wird durch den globalen Rechtsruck herausgefordert und zugleich markiert eben dieser die Notwendigkeit internationaler Solidarität.
Linke Kräfte halten den Widerstand gegen autoritär agierende Mächte und religiös-kulturelle Verbrämung von Herrschaftsverhältnissen lebendig und linke Bewegungen legen ihre Finger in die Wunden, die das sich global entfaltende Kapitalverhältnis in Gesellschaften und Individuen reißt.
Diese emanzipatorischen Politiken zivilgesellschaftlicher Akteur*innen sind dabei nicht mit Einflussnahmen und Regime-Change-Politiken von Staaten im Weltsystem gleichzusetzen. Auch Diplomatie- und Friedenspolitik sind nicht allein die Sache von Regierungen: Dies zeigen die Proteste russischer Soldatenmütter oder die erfolgreiche US-Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg - nur zwei Beispiele von vielen. Dennoch haben sich auch Staaten die Einwirkung auf die Zivilgesellschaften anderer Staaten gezielt als Form der Einflussnahme erschlossen, während sie sich die umgekehrte Einflussnahme als illegitime Einmischung in innere Angelegenheiten verbitten.
Regierungen haben das Recht, ihre wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu anderen Staaten an die Beachtung grundlegender Rechte wie Menschenrechte einschließlich Frauenrechte, Arbeitsrechte, ökologische Kriterien etc. zu binden. Um jedoch nicht zu einem Instrument einseitiger Herrschaftsinteressen zu werden, müssen derartige Kriterien gegenüber allen Staaten der Welt gelten. Unter dem Vorwand, dass Menschrechte verletzt wurden, wurde das Prinzip der staatlichen Souveränität (wie im Jugoslawienkrieg) durch militärische Interventionen immer wieder verletzt.
Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen rivalisierender kapitalistischer Mächte ist die Alternative zur staatlichen Souveränität nicht die globale Durchsetzung von Menschenrechten, sondern das interessengeleitete Gesetz des Stärkeren. Aus dem Prinzip der Souveränität der Staaten und des Friedens in der UN-Charta leitet sich jedoch kein Menschenrechtsnihilismus ab. In Fällen von Völkermord, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sieht die UN-Charta eng begrenzte Interventionsmöglichkeiten vor.
Interventionen können sich nicht allein auf einen ethischen Kodex berufen, sondern müssen durch den Sicherheitsrat mandatiert sein. Zugleich sind aber auch in den Mandaten der UN realpolitische Interessen wirksam – andernfalls würden sie im Sicherheitsrat keine Mehrheit finden. Diese realpolitischen Interessen setzten daher der Möglichkeit, innerhalb des Systems der UN legal unter Bezugnahme auf menschenrechtliche Normen oder einer postulierten Gefährdung des Friedens in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu intervenieren, auch Grenzen.
Während Staaten an das Prinzip der staatlichen Souveränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes gebunden sind, gilt dies nicht für politische Bewegungen, Parteien und NGOs. Linke Politik muss sich über das Spannungsverhältnis zwischen der Realpolitik zwischenstaatlicher Beziehungen und den Bestrebungen der Überwindung von Ausbeutung und Unterdrückung bewusst sein.
Während staatliche Politik das Prinzip der staatlichen Souveränität anerkennen muss, gilt auf der Ebene von Partei und Bewegung das Gebot der internationalen Solidarität und der Unterstützung und Zusammenarbeit mit emanzipatorischen Bewegungen in anderen Staaten.
Der Internationalismus linker Bewegungen von unten hat immer auch eine Alternative zu den machtpolitischen Praxen staatlicher Politik dargestellt. Ihre Vernetzungen sind zu stärken – gerade in unserer Zeit wachsender politischer Fragmentierungen im Weltsystem.
Keine außenpolitischen Doppelstandards
Unser Eintreten gegen außenpolitische Doppelstandards stellt kein bloßes moralisches Lamentieren dar, vielmehr ist sie konkreter Ausdruck praktischer Vernunft: Die in der Phase der unipolaren Weltordnung unter westlicher Hegemonie von NATO-Staaten praktizierten Doppelstandards bei der Bindung an internationales Recht drohen im multipolaren System vermehrt auch von nicht-westlichen Akteuren kopiert zu werden. Die offizielle Begründung der russischen Ukraine-Invasion gibt bereits ein warnendes Beispiel.
Die Akzeptanz und das Prägen von Doppelstandards stellen eine Gefahr für den Frieden dar, weil sie einen normativen Rahmen für den Bruch der UN-Charta schafft.
Demgegenüber setzen wir die Gültigkeit der Normen der UN ohne jeden Doppelstandard. Die Frage, ob Sanktionen ein Mittel imperialistischer Politik oder eine Alternative zur kriegerischen Durchsetzung internationalen Recht sind, hat in Der Linken lange für Kontroversen gesorgt. Wesentlich für die Bewertung von Sanktionen ist die Frage, wer sie warum in welcher Form und mit welchem Ziel erlässt. Grundsätzlich darf im Staatensystem nur sanktioniert werden, wer beziehungsweise was gegen die Normen der UN verstößt. Konkret sind Sanktionen mit klarer Zielsetzung (z.B. Eindämmung von Angriffskriegen), klar definiertem Ende bei Erreichen ihrer Ziele sowie einem Auswertungsmechanismus zu verbinden.
Die UN sind mit ihrer Charta das Rückgrat der einzigen global anerkannten Völkerrechtsordnung.
Ihr normativer Überschuss ist gezielt zu nutzen. Dies gilt zum Beispiel für die Gestaltung regionaler Sicherheitsarchitekturen, damit diese nicht die Logik klassischer Militärbündnisse duplizieren: Wo Kontrahenten miteinander interagieren, gilt es unterschiedliche und zum Teil gegensätzliche Sicherheitsbedürfnisse zu artikulieren, Transparenz zu schaffen und vertrauensbildende Maßnahmen zu ermöglichen.
Wir sind seit unserer Gründung für eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einbezug Russlands eingetreten. Mit dem jetzigen russischen Regime ist diese nicht erreichbar. Doch diese Vision aufzugeben, wäre dennoch falsch, weil es entscheidend ist für ein sicheres, ein friedliches Europa.
Das Eintreten gegen die russische Invasionspolitik bedingt nicht den Verzicht auf eine Perspektive zukünftiger Gemeinsamer Sicherheit. Doch wer Gemeinsame Sicherheit als praktische Idee nicht verwerfen möchte, muss Bedingungen formulieren: Dazu gehört uneingeschränkter Respekt gegenüber den Artikeln und Prinzipien der UN-Charta und es bedarf weiterer beidseitiger Schritte, die sich zum Beispiel an der Helsinki-Schlussakte orientieren können.
Es ist grundsätzlich zu bestimmen, wie Sicherheit aussehen kann und soll, die nicht zur Unsicherheit anderer wird. Aus dem in Artikel 51 der Charta der UN formulierten Selbstverteidigungsrecht lassen sich Streitkräfte ableiten, die fähig sind, bewaffnete Angriffe abzuwehren, nicht aber selbst erfolgreich durchzuführen.
Verteidigung: Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit untersetzen
Nicht alle Staaten achten die Souveränität von Dritten oder richten ihre Streitkräfte dem Primat Struktureller Nichtangriffsfähigkeit folgend aus. Europa und Deutschland sind historisch wie aktuell aktives Subjekt imperialistischer Politik und in unserer multipolaren Ordnung im zunehmenden Maße Objekt imperialistischer Interessen. Im Zuge der Rückkehr militärischer Staatenkonkurrenz ist weltweit zu beobachten, dass die Ausrichtung auf die Möglichkeit des klassischen Staatenkriegs heute wieder Militärparadigmen, Verteidigungs- und Rüstungsplanung beherrscht.
In den Jahrzehnten nach 1990 ist die Bundeswehr jedoch darauf ausgerichtet worden, zumeist überseeische Auslandseinsätze zur Sicherung von Handelswegen und zum imperialen Management der unipolaren Weltordnung durchzuführen. Die weitgehende Komplementarität mit US-Interessen erlaubte einen hohen Grad an funktionaler Arbeitsteilung auf militärischer Ebene. Die Spezialisierung der Bundeswehr auf Auslandseinsätze gegen schwächere Staaten wurde sowohl durch den Kollaps der UdSSR als auch das fortwirkende transatlantische Schutzversprechen durch die USA ermöglicht. Wachsendes militärisches Engagement Deutschlands im Ausland und gleichzeitig sinkende und später stagnierende Militärbudgets am Bruttoinlandsprodukt waren typisch für diese Zeit. Die Bundeswehr wurde auf Auslandseinsätze statt auf Landesverteidigung getrimmt. Schutzversprechen und Abhängigkeit im transatlantischen Bündnis bedingten sich dabei gegenseitig.
Seit der russischen Invasion der Ukraine 2022 und der offenen Infragestellung der transatlantischen Sicherheitsversprechen durch die Regierungen Trump I und Trump II hat sich der sicherheitspolitische Diskurs in Deutschland massiv verschoben: Die erklärte „Zeitenwende“ hat den Militäretat massiv ausgeweitet und im herrschenden politischen Klima entgrenzt sich der vorherrschende Sicherheitsbegriff immer weiter. Der Umgang mit realen äußeren Bedrohungen wird dabei nicht vor dem Hintergrund defensiv formulierter Verteidigungssinteressen verhandelt, sondern ist von machtpolitischen Interessen der eigenen Eliten und von industriellen Profitinteressen überformt. Anstelle emanzipatorischer Konzeptionen von Sicherheit drückt der vorherrschende Begriff umfassender Sicherheit den unterschiedlichen Aspekten von Sicherheit und Außenpolitik einen militärischen Stempel auf. Verteidigungsfähigkeit wird zur Kriegsfähigkeit ungeformt.
Während unsere Gesellschaft einen Rechtsruck durchläuft, rückt die Einführung der Wehrpflicht immer näher. Sicherheit durch Aufrüstung kann schnell zur Unsicherheit der Anderen werden.
Wie Sicherheit und Verteidigung organisiert werden, darf nicht dem Militär überlassen werden. Nur die Gesellschaft kann das verteidigungspolitische Restrisiko gegen das Risiko der Destabilisierung abwägen und dem militärischen Denken Grenzen ziehen. In der militärischen Logik schafft nur absolute Überlegenheit wirkliche Sicherheit; deshalb darf diese Logik nicht das letzte Wort haben. Das erfordert Auseinandersetzung mit der Problematik und Dialog auf Augenhöhe. Militarisierung liegt dagegen vor, wenn Aspekte des Zivilen der militärischen Logik untergeordnet und von ihr aus organisiert werden. Die Bereitschaft der Menschen zum Widerstand gegen eine bewaffnete Aggression ist ein gewichtiger Faktor.
Primat des Zivilen: Praxen eines zivilen Multilateralismus
Sicherheit ist vom Primat des Zivilen aus zu formulieren, die systemischen Wurzeln von Gewalt und Kriegen sind zuvorderst anzugehen.
Denn Verteidigung beginnt und endet nicht erst bei der militärischen Abschreckung oder gar Abwehr eines Angriffs durch eigene Streitkräfte. Bereits die glaubhafte Perspektive zivilen gesellschaftlichen Widerstands reduziert die Chance einer militärischen Invasion. Es ist wenig attraktiv, Staaten zu erobern, wenn diese schwer zu verwalten und damit auszubeuten sind, weil die Menschen Kollaboration und Kooperation verweigern und Generalstreiks gesellschaftliches Leben und Produktion wiederholt stilllegen. Dazu müssen die Menschen davon überzeugt sein, dass sie ein Gemeinwesen verteidigen, dessen soziale, demokratische und menschrechtliche Errungenschaften der Verteidigung wert sind. In diesem Sinne sind Fortschritt und Emanzipation selbst Teil unserer zivilen Verteidigungsfähigkeit. Demgegenüber unterhöhlt der gesellschaftlich-politische Rechtsruck sie von innen.
Sowohl Austerität als auch eine Politik der Hochrüstung auf den Schultern der breiten Bevölkerung gefährdet jenen gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf dem die Bereitschaft zur zivilen Verteidigung ruht.
Die unbedingte Bindekraft des Völkerrechtes begründet das Primat des Zivilen – übrigens nicht nur aus linker Perspektive. Das Militärische ist folglich nicht der Ausgangspunkt emanzipatorischer Konzeptionen von Sicherheit. Zugleich ist jedoch zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht alle Akteure im Weltsystem sich diesen Standards verpflichten oder sich von zu erwartender ziviler Verteidigung abschrecken lassen. Wo eigene emanzipatorische Errungenschaften und unsere Selbstbestimmung bedroht werden, dort gibt es ein populares Bedürfnis nach Sicherheit – übrigens auch im kapitalistischen Staat. Daher kann linke Politik populare Sicherheitsbedürfnisse nicht verneinen oder als Teil eines falschen, medial manipulierten Bewusstseins abtun.
Militärische Unterwerfung und Kontrolle dient der Absicherung von Ungleichheit und Rechtlosigkeit, auch im Verhältnis zu den abhängig beschäftigten Klassen des beherrschten und des beherrschenden Landes. Das ist Grund und Rechtfertigung aller antikolonialen Befreiungskämpfe und aller Bestrebungen nach nationaler Selbstbestimmung. Es ist eine schwere und doch notwendige Aufgabe aus linker Perspektive, die Frage der Landesverteidigung zu denken, ohne sich dabei zum Teil der gesellschaftlichen Militarisierungstendenz zu machen, ja sich dieser weiterhin zu wiedersetzen.
Der Gedanke, dass unsere Sicherheit niemals zur Unsicherheit der Anderen werden darf, begründet zusammen mit dem Angriffsverbot und dem Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta das im späten Kalten Krieg entstandene Konzept der Strukturellen Nichtangriffsfähigkeit.
Es ist damit mehr als nur ein normativ-idealistisches Postulat – trotz aller friedenspolitischen Rückschritte ist es in seinem Kern auch direkt aus allgemein akzeptiertem Völkerrecht ableitbar. Bereits das Erfurter Programm bekennt sich zur Idee der Strukturellen Nichtangriffsfähigkeit und zum Umbau der Bundeswehr auf Basis „strikter Defensivpotenziale“ und möchte die „kriegführungsfähigsten Teile der Bundeswehr“ zuerst abrüsten. Heute spricht der Verteidigungsminister von Ausrichtung auf Landesverteidigung und von Kriegsfähigkeit; der Inspekteur der Luftwaffe nennt sogar Siegfähigkeit. Offenkundig wird der Begriff der Verteidigungsfähigkeit immer offensiver ausgelegt. Auch deswegen steht linke Politik in der Verantwortung zu sagen, was militärische Verteidigung ist: Sie meint die Fähigkeit, sich erfolgreich im Falle eines Angriffs verteidigen zu können, nicht aber die Kapazität erfolgreiche Angriffskriege führen zu können.
Verteidigung, Abrüstung und Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit
Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Frieden und Sicherheit macht es notwendig, militärische Verteidigung und Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit miteinander zu verbinden. Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit und die dafür erforderlichen Defensivpotenziale sind in unserer Programmatik allerdings nicht näher untersetzt, das stellt ein Problem für ihre sicherheitspolitische Glaubwürdigkeit dar. Die gleiche Nichtuntersetzung kann zugleich auch Zweifel an unserer friedenspolitischen Zuverlässigkeit aufkommen lassen, weil sie auch den Rahmen für die friedenpolitische Entkernung des Konzeptes Struktureller Nichtangriffsfähigkeit bilden kann. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn unter Struktureller Nichtangriffsfähigkeit letztlich die derzeit vorherrschende Konzeption von Verteidigung übernommen würde. Weder ist sie wirklich defensiv ausgerichtet, noch gewährleistet sie reale Verteidigungsfähigkeit, da wesentliche Defensivpotentiale gegenwärtig von US-amerikanischer Unterstützung abhängen. Zudem gibt es keine per se Angriffs- oder Defensivwaffen.
Entscheidend ist vielmehr ihr Zusammenwirken im Verbund vor dem Hintergrund einer ausformulierten Militärdoktrin, einer spezifischen Struktur der Entscheidungswege sowie insbesondere der logistischen Kapazitäten und vieles mehr. Für uns ist es entscheidend zu überlegen, was Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit für Konsequenzen für die Bundeswehr hätte. Dann können wir auch unsere abrüstungspolitischen Forderungen besser fundieren. Militär basiert auf dem Prinzip von Befehl, Disziplin und Unterordnung. Auch deshalb ist die Frage der demokratischen Rechte von Militärangehörigen innerhalb der Streitkräfte ein Thema für linke, emanzipatorische Politik und die Auseinandersetzung mit antidemokratischen und rechtsextremen Haltungen in der Armee.
Eine besondere Schwierigkeit liegt darin, inmitten einer Welt des Unfriedens und wechselseitigen Hochrüstung Wege in die Abrüstung zu finden. Die Ausrichtung von Streitkräften auf Strukturelle Nichtangriffsfähigkeit ist integral mit Rüstungskontrolle zu verbinden, indem die Einladung zu gegenseitigen Inspektionen erfolgt. Ohne letztere können sich Dritte nicht sicher sein, dass deutsche und europäische Verteidigungspolitik dieses Ziel tatsächlich verfolgt.
Welche grundlegenden Bedingungen braucht es, um aus der Aufrüstungslogik heraus in eine Abrüstungslogik einzutreten?
Im Kalten Krieg gaben die beiden konkurrierenden Supermächte ihre Konkurrenz nicht auf. Doch sie konnten sich sukzessive darauf verständigen, die verschiedenen Levels ihrer militärischen Konkurrenz zu separieren und so politisch bearbeitbar zu machen. Einstiege in die Abrüstung wurden deswegen relativ niederschwellig möglich, ohne dass beide Seiten direkt vom Paradigma der Abschreckung abrücken mussten, was mit Gesichtsverlust verbunden gewesen wäre. Diese Trennung ermöglichte selbst unter Bedingungen scharfer Konfrontation, sich in Teilaspekten von Militär- und Sicherheitsfragen zu einigen, während in anderen die Konfrontation weiterlief. Gespräche über strategische Waffensysteme, deren Begrenzung und Rüstungskontrolle wurden geführt, während am Boden heiße Stellvertreterkriege geführt wurden. Vertrauen konnte langsam aufgebaut werden.
Mit der Aufgabe zahlreicher Rüstungskontrollregimes wurde in den letzten Jahrzehnten nicht einfach nur Rüstungskontrolle aufgegeben, sondern bis dato voneinander getrennte Teilbereiche militärischer Konkurrenz haben sich wieder miteinander verbunden: Im konkreten Kontext des Ukrainekrieges hat die Bundesregierung im Sommer 2024 bilateral mit den USA die Stationierung prinzipiell nuklearfähiger Mittelstreckenraketen beschlossen. Die Frage der Nuklearrüstung und strategischer Waffensysteme kann und sollte auch heute schon vom laufenden Ukrainekrieg und von anderen Kriegen separiert werden.
Die Fragen der Strukturellen Nichtangriffsfähigkeit and Abrüstung stellen sich heute unter anderen politischen und technologischen Voraussetzungen als in den 1980er-Jahren. Das Feld der Kriegführung hat sich in letzten Jahren widersprüchlich entwickelt: Einerseits ist die Möglichkeit eines großen konventionellen Staatenkrieges gewachsen, ja in der Ukraine bereits heute real. Doch die Technologien haben sich gewandelt, während zugleich die Technologien von damals anders eingesetzt werden als ursprünglich konzipiert. Der Ukrainekrieg ist zum Laboratorium konventioneller Kriegsführung geworden – besonders sticht dabei der Luftkrieg durch unbemenschte Drohnen heraus.
Wurden im Kalten Krieg die Luftkriegsmittel der konkurrierenden Blöcke tendenziell immer komplexer und teurer, so sehen wir derzeit eine Verbilligung der Luftkriegführung auf Basis breit verfügbarer ziviler Dual-Use-fähiger Massenproduktion. Populare Sicherheitsbedürfnisse werden berührt, wenn die Voraussetzungen zum Bombenkrieg sinken. Wie darauf im Sinne struktureller Nichtangriffsfähigkeit und Beschränkung auf Defensivpotentiale umgehen? Wie können Konzepte der Rüstungskontrolle aussehen, die dem gerecht werden?
Andererseits zeigt sich in der internationalen Staatenkonkurrenz in Form hybrider Kriegführung ein wachsender Rückgriff auf Methoden unterhalb des Niveaus eindeutig sanktionierter konventioneller Kriegführung: Teil hybrider Kriegführung stellen zum Beispiel Maßnahmen der gezielten Destabilisierung anderer Gesellschaften dar. Sie verbinden sich zudem mit der gegenwärtigen Konjunktur der politischen Rechten weltweit. Zugleich lassen sich unter dem Deckmantel der Bekämpfung hybrider Kriegführung oppositionelle Kräfte bekämpfen und Kriegsanlässe konstruieren.
- Wie werden wir der Problematik Hybrider Kriegführung gerecht, ohne dass wir zu einer Entgrenzung von Kriegsanlässen beitragen?
- Gibt es die Möglichkeit eines Prozesses vergleichbar des KSZE-Prozesses, der einen allseits akzeptierten Rahmen für zivilgesellschaftliches Wirken in anderen Staaten definieren kann?
Cyber-Kriegsführung
Eine neue quasi-militärische Methode, die unterhalb der Schwelle zum Krieg angesiedelt ist, aber ähnlich Auswirkungen haben kann, stellt Cyber-Kriegsführung dar. Besonders prädestiniert ist sie für Angriffe auf Verwaltung und Infrastrukturen, egal ob militärisch oder zivil. Sie trägt damit zur Entgrenzung der Kriegführung bei, die tendenziell auch erodierend auf die Normen der konventionellen Kriegführung rückwirken kann. Ebenso sind Cyberangriffe in ihrer Dimension nicht immer abschätzbar, das birgt die Gefahr einer ungewollt überdimensionierten Gegenreaktion. Zudem besteht die Gefahr einer bewussten, interessensgeleiteten Fehleinschätzung geringfügiger Cyberattacken zur Produktion scheinbar legitimer Kriegsgründe. Die Gefahren- und Eskalationspotentiale des Cyberkrieges werden weithin unterschätzt.
- Wie werden wir der Thematik gerecht, ohne dass wir zu einer Entgrenzung von Kriegsanlässen beitragen?
- Durch neue Formen der Rüstungskontrolle auf diesem Feld?
- Sind internationale Vertragsregimes denkbar, die Cyberkriegführung einhegen oder gar ähnlich wie ABC-Kriegführung ächten?
Die unipolare Weltordnung existiert nicht mehr.
Das US-Beistandsversprechen hat (dauerhaft) an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die USA möchten sich auf ihre (indo)pazifische Konkurrenz mit China konzentrieren, deswegen sollen die anderen NATO-Staaten mehr rüsten. Bereits die Trump I-Administration machte deutlich, dass es ohne Erreichen des NATO-2-Prozent-Ziels keinen US-Beistand im Falle eines Angriffs auf das Bündnis (mehr) gäbe. Das Bestreben der USA, Anfang 2025 sich mit Russland über die Ukraine zu verständigen und erst in einem zweiten Schritt die Ukraine und die europäischen Staaten konsultativ zu beteiligen, lässt – trotz der intensivierten europäischen Rüstung - die Zweifel an der US-Beistandsperspektive weiter anwachsen.
Bereits jetzt lässt die hohe Bereitwilligkeit der Mehrzahl der europäischen NATO-Staaten, stetig wachsenden NATO-Zielen und damit nationalen Rüstungsausgaben zuzustimmen, darauf schließen, dass eigene Rüstung unter der Hand auch das erodierte transatlantische Sicherheitsversprechen kompensieren soll. Mehrere Parteien wollen seit dem Bundestagswahlkampf die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee in Europa aufrüsten. Sicherheit nationalstaatlich zu organisieren, ist der teuerste und gefährlichste mögliche Rückschritt.
Die NATO kritisieren wir nicht aus Traditionsgründen, sondern weil sich mit ihr keine Politik der Strukturellen Nichtangriffsfähigkeit organisieren lässt und schon gar nicht eine Vision Gemeinsamer Sicherheit.
Deshalb fragen wir: Ist Europäische Verteidigung gemäß Art. 42 Abs. 7 EU-Vertrag organisierbar? Seine Beistandsverpflichtung ist strikt defensiv formuliert (defensiver als Art. 5 NATO-Vertrag). Für die Erfüllung der Beistandsverpflichtung ist keine EU-Armee und auch kein Angriff auf den Parlamentsvorbehalt erforderlich, stattdessen bedarf es einer arbeitsteiligen Koordination der Verteidigungspolitiken und kooperativer Kommandostrukturen. Dann würde eine glaubwürdige Sicherheitsperspektive jenseits der NATO möglich. Eine solche ist eine wesentliche Voraussetzung, um die EU strategisch unabhängig von den Interessen der USA zu positionieren und eine auf Ausgleich bedachte Außenpolitik zu verfolgen.
Nicht nur vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von US-Rüstungsimporten, sondern auch vor dem Hintergrund der Europäisierung der Verteidigung stellt sich Frage nach der Zukunft unserer bisherigen Rüstungsindustrien. Staatliche Rüstungskonzerne stellen per se keine Garantinnen für eine Verteidigungspolitik struktureller Nichtangriffsfähigkeit dar. Dennoch ist eine private Rüstungsindustrie ein Hindernis für eine solche, denn sie möchte über den politisch definierten Bedarf hinaus Geld verdienen und auch exportieren.
Rüstungskonzerne unter öffentlicher Kontrolle böten die Möglichkeit, Rüstung des Profits halber zu unterbinden.
Entscheidend ist also politische Zielsetzung und Ausgestaltung des Rahmens: Die Verstaatlichung der Rüstung müsste den Umbau der Streitkräfte in Sinne Struktureller Nichtangriffsfähigkeit absichern. Die öffentlichen Rüstungskonzerne dürften nur für den politisch-fachlich definierten Bedarf produzieren. Auch um die zersplitterte und ineffiziente deutsche Rüstungsindustrie zu konsolidieren und Kosten zu senken, müssen die Einzelunternehmen in öffentliches Eigentum überführt werden.
Seit Jahren wird versucht, deutsche Rüstungsexportrestriktionen aufzuweichen – u.a. durch gemeinsame europäische Projekte, zu denen deutsche Unternehmen ihre Komponenten zuliefern. Diese Beeinflussung nationaler Politik durch Europäisierung kann auch in die entgegengesetzte Richtung betrieben werden, um das Prinzip der Strukturellen Nichtangriffsfähigkeit zu befördern. In Weg in diese Richtung könnte es sein, Rüstungsexporte strikt auf Partner innerhalb der EU zu beschränken, die sich selbst dem Paradigma defensiver Verteidigung und struktureller Nichtangriffsfähigkeit verpflichten und ihre Industrien diesen Prinzipien entsprechend umbauen. Importe von Rüstungsgütern und Technologietransfer wären auf diese Staaten zu begrenzen. Damit einhergehend böte sich der Einstieg in die Verstaatlichung der europäischen Rüstungsindustrien bei hoher öffentlicher Transparenz durch strikte parlamentarische Kontrolle an.
Uns ist bewusst, dass (nicht nur) diese außen- und verteidigungspolitischen Vorschläge eine EU erfordern, in die andere Interessen eingeschrieben sind als die gegenwärtig herrschenden. Der tiefe Zusammenhang zwischen innerer Integrationsweise der EU und ihrem Außenverhalten erfordert eine grundlegende Reform der EU, die sie und damit uns zu einer anderen Außenpolitik befähigt. Gerade deshalb darf unsere Programmatik EU-Politik nicht zu einem Teilaspekt der Außenpolitik degradieren.