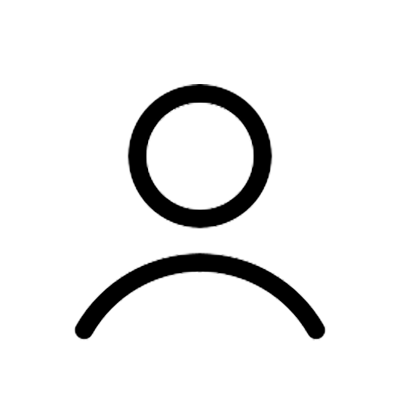Rosa Luxemburg, die Gewerkschaften und wir
Rosa Luxemburgs 1919 von protofaschistischen Freikorps gewaltsam beendetes „Leben für den Sozialismus“[1] ist auch im 21. Jahrhundert ein Vorbild für das konsequente Eintreten für eine nachkapitalistische Gesellschaftsordnung, wie sie im 2011 in Erfurt beschlossenen Grundsatzprogramm der Partei Die Linke anvisiert wird.[2] Die 1871 im, vom russischen Zarismus okkupierten, Polen geborene revolutionäre Marxistin, Internationalistin und Antimilitaristin vertrat anregende Ansichten über die Arbeit von Sozialist*innen in und mit den Gewerkschaften.[3] Einerseits klären Luxemburgs Auffassungen in realistischer Weise über effektvolle Möglichkeiten fortschrittlicher Betriebsarbeit auf. So lassen sich übertriebene Erwartungen oder „Illusionen“ (ARS, 81)[4], wie sie es selbst genannt hätte, vermeiden und zugleich unnötige Enttäuschungen umgehen. Ihre Auffassungen spornen andererseits dazu an, den kollektiven Organisationen namens Gewerkschaften, die sich Lohnabhängige frei nach dem von Ton Steine Scherben popularisierten Motto „Allein machen sie Dich ein“ zur Verteidigung ihrer ökonomischen Interessen gegeben haben, nicht als einer fremden Entität gegenüberzutreten. Denn, so Luxemburg, „[d]en unmittelbaren Interessen seines wirtschaftlichen Kampfes kann [der Arbeiter] […] nicht anders genügen als durch den Beitritt zu einer Berufsorganisation.“ (PS, 213)[5] Deshalb lassen sich die ‚Arbeitskraftverkaufsagenturen‘[6] als das natürliche Terrain sozialistischen Wirkens begreifen, welches zugleich weit über den engen Kreis linker Szenen hinausweist. Schließlich befand schon Karl Marx, dass den Gewerkschaften der „Todesstoß“ drohe, wenn sie sich von einer bestimmten politischen Partei abhängig machen würden.[7] Dieses Terrain weist demnach eben auch ganz eigene Logiken auf, die sich von denen einer Linkspartei unterscheiden und denen wir uns mit der Hilfe Rosa Luxemburgs und anderer verständig nähern können.
Hüterinnen der Demokratie
Die US-Schauspielerin Susan Sarandon brachte in einem Gespräch mit dem einstigen Minengewerkschaftsführer Richard Trumka eine entscheidende Einsicht zum Ausdruck, die Millionen gewerkschaftlich aktiver lohnabhängig Beschäftigter weltweit immer wieder von Neuem aus ihrem Engagement ziehen: Sarandon sprach von der in gewerkschaftlicher Arbeit gemachten Erfahrung branchenübergreifender wechselseitiger Unterstützung bei Arbeitskämpfen (für die das hierzulande von den DGB-Gewerkschaften bei Ausständen ihren Mitgliedern gezahlte Streikgeld nur ein sinnfälliges Beispiel unter vielen bietet). Diese Erfahrung habe ihr „die Bedeutung von Solidarität“ vermittelt.[8] Bruce Springsteen stieß ins gleiche Horn. Der Rock-Poet hat nicht nur immer wieder die Lage der US-amerikanischen Arbeiterklasse im Neoliberalismus besungen – am prägnantesten auf seinem 2012 veröffentlichten Album Wrecking Ball. Er hat auch einen wichtigen Merksatz zum Sinn von Gewerkschaften geprägt: „Was auch immer ihre Mängel sein mögen, so waren die Gewerkschaften doch die einzige mächtige und wirkungsvolle Stimme, die die arbeitenden Menschen jemals in der Geschichte dieses Landes hatten“[9].
Anders als in den USA haben arbeitende Menschen in der heutigen Bundesrepublik bei ihrer Suche nach Unterstützung beim Widerstand gegen die vielfältigen „Mechanismen der Unterdrückung“[10] zweifellos nicht ‚nur‘ die Gewerkschaften zur Hand. Anders als in den Vereinigten Staaten besitzen sie hierzulande bundesweit gesetzlich festgelegte umfassende betriebliche Mitbestimmungsmöglichkeiten, Arbeitnehmer*innenrechte und soziale Errungenschaften. Diese der sogenannten Arbeitgeberseite sowie den politisch Herrschenden abgetrotzten Errungenschaften werden zwar von der aktuellen Merz-Regierung bedroht – Stichwort: Angriff auf den Acht-Stunden-Tag. Sie sind aber durch das im Grundgesetz niedergeschriebene Prinzip des sozialen und demokratischen Rechtsstaates als bundesrepublikanischem Staatsziel geschützt[11] – ein Ziel, das freilich im Widerspruch zur wenig demokratischen „Wirtschaftsverfassung“[12] des real existierenden Kapitalismus in Deutschland steht. In diesem Sinne betrachtete der einflussreiche Verfassungsinterpret Wolfgang Abendroth die Gewerkschaften als „die natürlichen Hüter der Demokratie“. Sie fungieren aus seiner Sicht als „Korrektiv zum Parteiensystem und Parteienstaat, das ihn allein stets in den Bahnen jener Prinzipien halten kann, auf die ihn das Grundgesetz verpflichtet hat: demokratisch und sozial zu werden.“[13] Die Gewerkschaften und die Lohnabhängigen können sich also auf das vorgenannte Prinzip des sozialen und demokratischen Rechtsstaates berufen – und müssen ihm zugleich zum Durchbruch verhelfen.
Als Parteiersatz sollten die Gewerkschaften jedoch nicht missverstanden werden[14], zumal Rosa Luxemburg keine Gegnerschaft zwischen ihnen und der sozialistischen Partei aufkommen lassen wollte (ARS, 236-246). Die von Marx geforderte Unabhängigkeit ist also nicht als Gegensatz gedacht, auch wenn die eben erwähnte Korrektivfunktion durchaus auch für linke Parteien Gültigkeit hat. So kann es mitunter erforderlich sein, dass die Arbeitnehmer*innenorganisationen auch unsere Partei daran erinnern, dass beispielsweise hinter der immer wieder aufflammenden Diskussion um ein (noch) höheres Renteneintrittsalter das handfeste Interesse der Gegenseite an faktischen Rentenkürzungen steckt.
Deshalb ist es konsequent und richtig, dass Die Linke mit den Beschlüssen des Chemnitzer Parteitages vom Mai 2025 ihre Genoss*innen dazu ermutigt, „an ihrem Arbeitsplatz die Gewerkschaftsbewegung [zu] stärken“ und „eine betriebliche Praxis der Linken [zu] entwickeln“. Vor diesem Hintergrund bietet eine aufmerksame Kenntnisnahme und kreative Rezeption von Positionen kämpferischer Sozialist*innen früherer Generationen, wenn auch unter gänzlich anderen Bedingungen erarbeitet, anregende Impulse im Sinne von Antonio Gramscis Merksatz: „Die vergangenen Lösungen bestimmter Probleme helfen, die Lösung der ähnlichen aktuellen Probleme zu finden“[15]. Der Chemnitzer Parteitag identifizierte als „die zentrale Aufgabe der Linken, sich in der Arbeiter*innenklasse zu verwurzeln, um die Durchsetzungskraft von uns allen gegen ‚die da oben‘ zu erhöhen.“ Deshalb ruft die Partei „alle unsere Mitglieder dazu auf, Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft zu werden und sich am Arbeitsplatz zu organisieren.“
2017 war ein Drittel der Mitglieder der Partei Die Linke in einer Gewerkschaft organisiert. Was wie ein niedriger Wert klingt, ist einerseits ins Verhältnis zur Tatsache zu setzen, dass Die Linke mit dieser Zahl in Deutschland die Partei mit dem höchsten Gewerkschafter*innen-Anteil nach der SPD ist, die ihrerseits 2017 auf den nur knapp höheren Wert von 35 Prozent kam.[16] Andererseits hat die Partei seit 2017 einschneidende Entwicklungen (darunter ein imposantes Anwachsen der Gesamtmitgliederzahl seit Anfang 2025) durchlaufen, die begründet vermuten lassen, dass der Anteil gewerkschaftlich organisierter Mitglieder zwischenzeitlich gesunken ist. Da der „Bezug zu den Gewerkschaften“ für eine „Partei mit sozialistischem Anspruch“ jedoch „zentral“ ist[17], wird der Aufruf zur Organisierung zur dringenden Tagesaufgabe, mit deren Erfüllung die Arbeiterklasse aufhört, „das unbekannte Wesen“[18] zu sein. Dementsprechend ersetzt die Kenntnisnahme einiger, unter anderen historischen Bedingungen geprägten Aussagen zur Gewerkschaftsarbeit auch nicht eine Gewerkschaftstheorie auf der Höhe unserer Zeit, die nur mit Hilfe tatsächlicher Gewerkschaftspraxis gewonnen werden kann.[19] Mit Rosa Luxemburg und Co. als ortskundigen guides begeben wir uns aber auf den Weg dorthin.
Unentbehrliche Sisyphusarbeit
Nähert man sich dem Thema vom Ende des Wirkens Rosa Luxemburgs her, stößt man zunächst auf Äußerungen, die die soeben zitierte emphatische Orientierung der Partei Die Linke auf die Arbeit in den Gewerkschaften alles andere als naheliegend erscheinen lassen. So plädierte Luxemburg auf dem Gründungsparteitag der KPD zum Jahreswechsel 1918/19 für eine „Liquidierung der Gewerkschaften“. Dies war die Folge einer Enttäuschung über jene SPD- und Gewerkschaftsführer, die während des Ersten Weltkrieges auf den Burgfrieden mit Militarismus, Monarchie und Monopolkapital statt auf die gemeinsame Aktion der Proletarier*innen aller Länder zur Beendigung des Gemetzels gesetzt hatten und sodann die Novemberrevolution abzudrosseln suchten.[20] Die gewerkschaftlichen Aufgaben sollten aus Luxemburgs Sicht von den Arbeiterräten übernommen werden. Sie wurde hierfür posthum von ihrem russischen beziehungsweise sowjetischen Genossen Lenin kritisiert[21], an dem sie ihrerseits zu Lebzeiten – trotz prinzipieller Übereinstimmung in grundsätzlichen Fragen[22] – mit Kritik nicht gespart hatte. Luxemburgs Forderung war auch unter dem Eindruck der Rätebewegung formuliert worden und damit einer sehr spezifischen Situation geschuldet. Sie wurde von der laut unserem Parteiprogramm „zum historischen Erbe der Linken“ gehörenden KPD nicht wieder aufgegriffen.
Die westdeutsche KPD verbreitete allerdings 1951 in der Frühphase des Kalten Krieges die irrige These, dass die Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes als Auftragnehmer „des amerikanischen Imperialismus und im Einklang mit den deutschen Monopolisten“ im Begriff sei, „die Gewerkschaftsorganisationen in den Dienst der Kriegsvorbereitungen zu stellen“[23]. Die in dieser Situation mit Blick auf die in der Adenauer-BRD wiedereinsetzende Verfolgung von Kommunist*innen und anderen Linken[24] dringend zu vermeidende Isolation wurde in der Folge verstärkt. Die KPD-Führung hatte es den rechtssozialdemokratischen Segmenten im DGB mit dieser sektiererischen Behauptung spielend leicht gemacht, unliebsame Kommunist*innen los zu werden. Diese hatten kurz nach dem Krieg imposante Stellungen in den Gewerkschaften und in der betrieblichen Interessenvertretung errungen: So war noch Ende der 1940er Jahre im Ruhrgebiet jeder dritte Betriebsrat KPD-Mitglied.[25] Bei dieser erfolgreichen Arbeit im Interesse der Beschäftigten waren sicherlich viele auch von früher geäußerten gewerkschaftspolitischen Vorstellungen Rosa Luxemburgs inspiriert, die sich von ihrer Spätforderung nach „Liquidierung“ drastisch unterschieden.
Ausgehend von der Marxschen Grundidee eines Doppelcharakters der Gewerkschaften, lassen diese sich als „Ordnungsfaktor und Gegenmacht“ zugleich[26] begreifen. Sie stehen in einem Spannungsfeld zwischen Integration und Autonomie.[27] Sie operieren auf der Grundlage eines Systems, in dem die große Mehrheit der Menschen dazu gezwungen ist, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen, und sind somit im Bestreben danach, die Bedingungen und Resultate dieses Verkaufs zu optimieren, an dieses gebunden. Hierin verschaffen sie den arbeitenden Menschen jedoch eine Freiheit von bestimmten Auswüchsen dieses Systems und befähigen sie, den ihnen gegenüber zunächst als stärkere Partei auftretenden Käufern ihrer Arbeitskraft und Aneignern des von ihnen produzierten Mehrwerts in Verhandlungen als starke (im Optimalfall geschlossene) Gruppe gegenüberzutreten und ihre gesellschaftliche Stellung zu verbessern, sodass sie wirksam werden können, ohne bloß Marktlogiken und Profitdominanz unterworfen zu sein. Hierbei ist es nicht eine vermeintliche fetischhafte Fixierung auf den Arbeitsplatz, die das gewerkschaftliche Wirken strukturiert. Vielmehr besteht „der Schlüssel zu einem reicheren sozialen und kulturellen Leben jenseits der Arbeit“, also einer Freizeit mit mehr Freiheit, „darin […], mehr Macht auf der Arbeit selbst zu haben.“[28] Machtfragen sind demnach Freiheitsfragen. Freiheitsfragen führen an die Systemfrage heran.[29] Diese Systemfrage lässt sich perspektivisch durch das Stellen der Machtfrage lösen.
In der Zwischenzeit finden wir Luxemburgsche Impulse zur Thematik bereits in ihrem erstmals 1899 unter der Überschrift Sozialreform oder Revolution? publizierten Beitrag zur Revisionismusdebatte in ihrer damaligen Partei, der SPD. Auch wenn sie dort festhält, dass die Gewerkschaften sich „in der Hauptsache auf den Lohnkampf und die Verkürzung der Arbeitszeit [beschränken]“ (PS, 33) und demnach „das Lohngesetz nicht umstürzen“, sondern „im besten Falle die kapitalistische Ausbeutung in die jeweilig ‚normalen‘ Schranken weisen [können]“ (PS, 31), definiert sie die gewerkschaftliche Arbeit als „unentbehrlich[e]“ „Sisyphusarbeit“ (PS, 68). Hierbei weist Luxemburg den Gewerkschaften als „organisierte[r] Defensive der Arbeitskraft gegen die Angriffe des Profits“ (ebd.) folgende konkrete Funktionen zu: „Erstens haben die Gewerkschaften die Aufgabe, die Marktlage der Ware Arbeitskraft durch ihre Organisation zu beeinflussen […]. Zweitens bezwecken die Gewerkschaften die Hebung der Lebenshaltung, die Vergrößerung des Anteils der Arbeiterklasse am gesellschaftlichen Reichtum“ (ebd.).
In ihrer 1900, das heißt nur wenig später veröffentlichten Polemik gegen den bürgerlichen Soziologen (und späteren Faschisten) Werner Sombart erinnert sie an die „Arbeiterverhältnisse vor dem Beginn der gewerkschaftlichen Bewegung“[30] (ARS, 106). Luxemburg beschreibt „erstens die große Unsicherheit, das heißt Ungleichmäßigkeit in der Lage des Arbeiters in verschiedenen Zeiten, und zweitens die große Ungleichmäßigkeit zu jeder Zeit in der Lage verschiedener Schichten der Arbeiterschaft.“ (ARS, 106f.) Als Antwort auf die Monthy-Pythoneske Frage, was die Gewerkschaften eigentlich je für uns erreicht haben[31], könnte man ihre folgende Ausführung lesen: „Hier schaffen die Gewerkschaften, wenn sie die allgemeinen Interessen der Arbeiter als Klasse im Auge behalten, gründlichen Wandel. Indem sie in den Perioden des Aufschwungs das durch den Profit zulässige Maximum an Löhnen erringen, um aus ihnen die Abwehrkämpfe in den Perioden des Niederganges zu speisen, indem sie das unterste Niveau der Lebenshaltung der Masse heben und zugleich die bestsituierten Berufe zur allgemeinen Organisation herbeiziehen, indem sie endlich sowohl in jedem Beruf, wie für die Klasse allgemeine Regeln (Arbeitszeit usw.) schaffen, führen sie eine Ausgleichung der Lebenslage des Proletariats in verschiedenen Phasen der Produktion wie zwischen seinen verschiedenen Schichten und eine gewisse Stabilität dieser Lebenslage herbei.“ (ARS, 107) Und so fußt eine solidarische Kritik an Formen und Ergebnissen gewerkschaftlichen Handelns stets auf der Beachtung der „Stellung der lohnabhängig Arbeitenden in der kapitalistischen Klassengesellschaft, ihre[r] Bedürfnisse und Interessen“, und auf der Frage, ob diese „zum Ausgangspunkt und Prinzip“ eben jenes Handelns erhoben wurden.[32] Im Bestfall formuliert man eine solche Kritik, nachdem man an gewerkschaftlichem Handeln selbst teilgenommen hat, also einen bloß kommentierenden Beobachterstandpunkt vermeidet.
Gewerkschaft und Gesellschaft
Luxemburg unterschied die Gewerkschaften „von der politischen Partei des Proletariats“ dadurch, dass sie „nur unmittelbare Gegenwartsinteressen der Arbeiter“ (ARS, 113) vertreten würden. Jedoch begriff sie die Gewerkschaften nicht als politisch neutral (ARS, 138-150). Wie könnte eine inmitten des Klassenkampfes stehende Organisation dies auch sein? Angesichts des, ökonomische wie politische Aspekte vereinigenden, Charakters dieses Klassenkampfes (vgl. PS, 207) nehmen ökonomische Konflikte demnach häufig politischen Charakter an[33]: „[I]n ihrer Entwicklung [werden die Gewerkschaften] durch diese selben Interessen dahin gedrängt, erstens ihren Errungenschaften in jedem Lande durch gesetzliche Normen immer mehr eine allgemeine Gültigkeit zu geben und zugleich eine internationale Zusammenfassung ihrer Kräfte herbeizuführen, zweitens in ihrer gesamten Politik, wie: der Stellung zu den Streiks, zur Frage des Minimallohns, […] der Tarifgemeinschaften, des Maximalarbeitstages, der Arbeitslosenunterstützung, der Frauenarbeit, der Ungelernten, der ausländischen Einwanderung, der Einmischung in die Technik der Produktion, des Rechtes auf angemessene Arbeit, der Zoll- und Steuerpolitik usw. – sich immer mehr auf die allgemeinen sozialen Zusammenhänge zu stützen und mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu rechnen.“ (ARS, 113) Zugleich bildet „der gewerkschaftliche Kampf […] das vorzüglichste Mittel“ (ARS, 81), um an den politischen Kampf heranzuführen. Und so verbinden sich gesellschaftliche Zukunftsfragen, die Luxemburg an anderer Stelle für die sozialistische Partei reservierte (PS, 208), anschaulich mit den Gegenwartsinteressen. Daher überrascht es nicht, dass Rosa Luxemburg 1910 die Gewerkschaften auf dem Hagener Kongress des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, dem Vorgänger der heutigen IG Metall, als „unsere Kanonen im Kampfe um eine bessere Zukunft“ (ARS, 370) feierte.
Diese historischen Ausführungen lesen sich äußerst aktuell. Denn insbesondere die im Deutschen Gewerkschaftsbund vereinten Berufsvertretungen besitzen ein politisches Mandat, „das Grundfragen der Demokratie, der Sozialstaatlichkeit sowie von Krieg und Frieden betrifft.“[34] Anders als es die Agitation beispielsweise von AfD-nahen Pseudo-Gewerkschaften behauptet, die auf eine Zurückdrängung tatsächlicher betrieblicher Mitbestimmung und gewerkschaftlicher Selbstorganisation zielen, geht es bei der Wahrnehmung dieses Mandats nicht um sachfremde „Politisierung und Hetze“.[35] Ganz im Gegenteil betrifft es die (nicht nur sozial-)politischen Rahmenbedingungen des Lebens der Lohnabhängigen, mit denen sich Gewerkschaften früher oder später stets konfrontiert sehen, da sie zugleich den Rahmen ihres eigenen Handelns bilden. Dass bei der Wahrnehmung dieses politischen Mandats Gewerkschaftsverbände in anderen europäischen Ländern weiter sind als der DGB, ist kein Geheimnis. Man denke nur an die CGT in Frankreich und ihre klare und praktisch werdende Positionierung gegen die Lieferung von Waffen, die Israel bei seinen Verbrechen im Gazastreifen einsetzt. Hierbei bedienen sich die französischen Kolleg*innen des Mittels des politischen Streiks, also eines jenseits von Tarifauseinandersetzungen stattfindenden Ausstands. Dieses Beispiel macht anschaulich, wie die metaphorischen Kanonen des Kampfes um die Zukunft die Verladung von ganz realen Kanonen in der Gegenwart zu verhindern helfen. Für das Recht auf politischen Streik auch in Deutschland setzt sich demgemäß Die Linke ein.
Als komprimiertester Text Luxemburgs zum Themenkomplex gilt gängigerweise ihre Schrift Massenstreik, Partei und Gewerkschaften von 1906. Über diese ist bereits viel geschrieben worden.[36] An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Schrift im Kern versucht, die Erfahrungen der von Luxemburg frenetisch begrüßten Russischen Revolution des Jahres 1905, an der sie auch selbst teilnahm, auszuwerten. Bei vielen Deutungen wird übersehen, dass Luxemburg mit dem eben häufig als ‚politischer Streik‘ in die heutige Zeit übertragenen Begriff des ‚Massenstreiks‘ ausdrücklich „nicht einen einzelnen Akt“ (PS, 176) bezeichnet, sondern das Wort als „Sammelbegriff einer ganzen jahrelangen, vielleicht jahrzehntelangen Periode des Klassenkampfes“ (PS, 169) nutzt. Entsprechend des konkreten historischen Hintergrundes sieht sie diese Klassenkampfperiode zudem als „mit einer Revolutionsperiode identisch“ (PS, 176). Sie bezeichnet den Massenstreik sogar als „wirksam nur im Zusammenhang mit einer revolutionären Situation“ (ARS, 452). Berücksichtigt man den wichtigen Hinweis, dass weder Marx noch Engels unfehlbar waren[37] und dies ganz sicherlich gleichfalls für ihre Schüler*innen gilt, so lassen sich dennoch auch für nichtrevolutionäre Zeiten wie den unsrigen aus Massenstreik, Partei und Gewerkschaften Inspirationen ziehen. So erinnert die Autorin daran, dass „Gewerkschaften, wie alle Kampforganisationen des Proletariats, sich selbst nicht auf die Dauer anders erhalten als gerade im Kampf“ (PS, 190 – vgl. auch ARS, 334).
In anderer Hinsicht muss das Denken Luxemburgs als geschichtlich überholt charakterisiert werden. Sie beschreibt das „Verhältnis der Gewerkschaften zur Sozialdemokratie“ als das Verhältnis „eines Teiles zum Ganzen“ (PS, 208). Mit „Sozialdemokratie“ meint sie 1906 nichts anderes als die Partei des politikfähigen Marxismus, wie ihre unprätentiösen Verweise auf das Marx-Engelssche Manifest der Kommunistischen Partei im gleichen Atemzug zeigen. Im Zeitalter der Einheitsgewerkschaften sehen wir hier eine Grenze ihrer Überlegungen, die zudem einen Widerspruch zur weiter oben zitierten Marxschen ‚Unabhängigkeitserklärung‘ aufweisen. Die im DGB vereinten Einzelgewerkschaften sind als solche Einheitsgewerkschaften konzipiert. Als Lehre aus der Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung angesichts des Machtantritts des Nazismus 1933 sollen sie unterschiedliche antifaschistische Richtungen in ihrer Mitgliedschaft repräsentieren.[38] Aber auch das ist nicht gleichbedeutend mit Neutralität, denn „Einheitsgewerkschaft und politisches Mandat [gehören] zusammen: Ohne den Zustand der Einheit werden die Gewerkschaften ihr politisches Mandat nicht wahrnehmen können und ohne die Wahrnehmung des politischen Mandats lässt sich die Einheit schwerlich herstellen.“[39] Zugleich ist das ebenfalls vom DGB vertretene Prinzip der Industriegewerkschaften, das danach strebt, alle in einem Sektor Beschäftigten im selben Verband zu organisieren, ein probates Mittel, um die Marxsche Forderung nach einer Rolle der Gewerkschaften „als Vorkämpfer und Vertreter der ganzen Arbeiterklasse“[40] zu erfüllen.[41] Zwar ist die von Luxemburg bei Marx geborgte[42] abwertende Formel vom „ökonomischen Kleinkrieg“ (PS, 218) keine hilfreiche Bezeichnung für gegenwärtige Tarifkonflikte. Dennoch bleibt ihre Warnung davor richtig, durch die alleinige Fixierung auf die Lohnpolitik andere Formen der „Herabdrückung der proletarischen Lebenshaltung durch den Brotwucher, durch die gesamte Steuer- und Zollpolitik, durch den Bodenwucher, der die Wohnungsmieten in so exorbitanter Weise in die Höhe getrieben hat“ (ebd.), aus den Augen zu verlieren.[43]
Derzeit sind knapp fünfeinhalb Millionen Beschäftigte in Deutschland in jeweils einer der acht Gewerkschaften des DGB organisiert. Bei über 45 Millionen Lohnabhängigen insgesamt ist hier also noch Luft nach oben, die man am besten mit einer Arbeit im Sinne der eingangs genannten Parteitagsbeschlüsse der Linken füllt. Im Rahmen dieser Arbeit sollten wir aufhören, von den Gewerkschaften in der dritten Person zu sprechen, und anfangen, uns als Teil von ihnen zu begreifen. Schließlich wächst „[m]it dem Umfang und der Massenhaftigkeit der Bewegung […] auch die Gründlichkeit der Masse, deren Bewegung sie ist“ (ARS, 485), um Rosa Luxemburg das Schlusswort zu erteilen. Zugleich empfiehlt sich Geduld als Leitprinzip des politischen Handelns, denn: „Was auf geistiger Erkenntnis, auf innerer Überzeugung, auf freiem Entschluß der Arbeiterklasse beruht, reift langsam, schreitet zäh und bedächtig vorwärts. Jeder Fußbreit an Klassenkampfaufklärung und Organisation des modernen Proletariats ist in geduldigem hartem Ringen erkämpft worden.“ (ARS, 488f.)
[1] Lelio Basso (Hrsg.): Rosa Luxemburg. Una vita per il socialismo, Mailand: Feltrinelli 1973. Alle in den Originalquellen nicht deutschsprachigen Zitate wurden vom Autor des vorliegenden Beitrages übersetzt.
[2] Dass in diesem Sozialismus Luxemburgs ablehnende Äußerungen über das Selbstbestimmungsrecht der Völker keinen Modellcharakter haben können, versteht sich anhand der Vorsilbe ‚demokratisch‘ beinahe von selbst. Vgl. hierzu der ansonsten nicht für Treffsicherheit bekannte Leo Trotzki: Geschichte der Russischen Revolution. Band 2. Oktoberrevolution [1930], Essen: Mehring 2010, S. 339.
[3] Ein lehrreicher Überblick findet sich bei Malte Meyer: Rosa Luxemburg über die Gewerkschaften – und jene über sie, in: Frank Jacob / Albert Scharenberg / Jörn Schütrumpf (Hrsg.): Rosa Luxemburg. Band 1: Leben und Wirken, Marburg: Büchner 2021, S. 273-313.
[4] Alle Verweise im Text auf das Kürzel ARS in Kombination mit einer Seitenzahl beziehen sich auf Rosa Luxemburg: Ausgewählte Reden und Schriften. Band II, Berlin (Ost): Dietz 1951.
[5] Alle Verweise im Text auf das Kürzel PS in Kombination mit einer Seitenzahl beziehen sich auf Rosa Luxemburg: Politische Schriften. 2. Aufl., Leipzig: Reclam 1970.
[6] Rainer Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften. Zur Aktualität der Marxschen Gewerkschaftstheorie. 2. Aufl., Frankfurt/Main: Suhrkamp 1982, S. 149.
[7] Vgl. Johann Heinrich Wilhelm Hamann: Marx über Gewerksgenossenschaften [1869], in: Karl Marx / Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Erste Abteilung. Band 21, Berlin: Akademie Verlag 2009, S. 906f., hier S. 906. Zur Authentizität und Rezeption dieser Passage vgl. John Anthony Moses: Trade Union Theory from Marx to Wałęsa, New York: Berg 1990, S. 59-75.
[8] Zitiert nach Robert Struckman: Sarandon: „I’ve Always Known that Unions Made America”, in: AFL-CIO Now, 28. April 2012, online unter: https://web.archive.org/web/20170308230353/http://www.aflcio.org/Blog/Organizing-Bargaining/Sarandon-I-ve-Always-Known-that-Unions-Made-America.
[9] Zitiert nach Unbekannte*r Autor*in: Springsteen in tune with striking workers, in: AFL-CIO News, 22. Januar 1996, S. 7.
[10] Filippo Barbera: Auf der Seite der Unterdrückten oder gegen die Unterdrücker. Die ethische Betrachtung ist ein schlechter Ersatz für die politische Analyse, 3. Oktober 2024, online unter: https://www.kommunisten.de/rubriken/wahlen-in-europa/9154-auf-der-seite-der-unterdrueckten-oder-gegen-die-unterdruecker.
[11] Vgl. Phillip Becher: „From a Merely Political to a Social Democracy”. Wolfgang Abendroth, Palmiro Togliatti and the Constitutional Anti-Fascism in Post-War Italy and West Germany, in: Materialismo Storico, 16. Jg., Nr. 1 / 2024, S. 112-140, hier S. 115-120.
[12] Wolfgang Abendroth: Demokratie als Institution und Aufgabe, in: Die Neue Gesellschaft, 1. Jg., Nr. 1 / 1954, S. 34-41, hier S. 38.
[13] Wolfgang Abendroth: Zur Funktion der Gewerkschaften in der westdeutschen Demokratie, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 3. Jg., Nr. 11 / 1952, S. 641-648, hier S. 648.
[14] Vgl. Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften, a.a.O., S. 9.
[15] Antonio Gramsci: Gefängnishefte. Band 4. Hefte 6 und 7 [1930-1932], Hamburg: Argument 2012, S. 778.
[16] Vgl. Markus Klein / Philipp Becker / Lisa Czeczinski / Yvonne Lüdecke / Bastian Schmidt / Frederik Springer: Die Sozialstruktur der deutschen Parteimitgliedschaften. Empirische Befunde der Deutschen Parteimitgliederstudien 1998, 2009 und 2017, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 50. Jg., Nr. 1 / 2019, S. 81-98.
[17] Heinz Bierbaum: Die LINKE als Protagonist der Transformation. Plädoyer für eine konstruktive Erneuerung der Partei, in: Luxemburg – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, 17. August 2023, online unter: https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/die-linke-als-protagonist-der-transformation.
[18] Fabian Lehr: Der Arbeiter – das unbekannte Wesen, 6. Mai 2025, online unter: https://www.youtube.com/watch?v=BwP0BnuOvws.
[19] Vgl. Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften, a.a.O., S. 12.
[20] Vgl. Sebastian Haffner: Die deutsche Revolution 1918/1919 [1969], Reinbek: Rowohlt 2004.
[21] Wladimir Iljitsch Lenin: Bericht des Zentralkomitees, 18. März [1919], in: derselbe: Werke. Band 29, Berlin (Ost): Dietz 1984, S. 131-149, hier S. 141.
[22] Vgl. Ulla Plener: Rosa Luxemburg und Lenin. Gemeinsamkeiten und Kontroversen. Gegen ihre dogmatische Entgegenstellung, Berlin: NoRa 2009.
[23] Kommunistische Partei Deutschlands: Die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der KPD. Entschließung des Münchner Parteitags (3.-5.3.1951), in: Günter Judick / Josef Schleifstein / Kurt Steinhaus (Hrsg.): KPD 1945-1968. Dokumente. Band 1, Neuss: Edition Marxistische Blätter 1989, S. 335-380, hier S. 355.
[24] Josef Foschepoth: Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017.
[25] Georg Fülberth: KPD und DKP 1945-1990. Zwei kommunistische Parteien in der vierten Periode kapitalistischer Entwicklung. 2. Aufl., Heilbronn: Distel 1992, S. 34.
[26] Vgl. Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften, a.a.O., S. 7.
[27] Frank Deppe: Autonomie und Integration. Materialien zur Gewerkschaftsanalyse, Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft 1979.
[28] Vivek Chibber: Das ABC des Kapitalismus. Band III. Kapitalismus und Klassenkampf. 3. Aufl., Berlin: Brumaire 2021, S. 15.
[29] Vgl. Reinhard Opitz: Der Sozialliberalismus [1972], Berlin (West): Argument 1979, S. 50.
[30] Vgl. allgemein Frank Deppe / Georg Fülberth / Jürgen Harrer: Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. 4. Aufl., Köln: Pahl-Rugenstein 1989.
[31] Vgl. Len McCluskey: Why You Should Be a Trade Unionist, London / New York: Verso 2020, S. 25.
[32] Frank Deppe / Jutta von Freyberg / Christof Kievenheim / Regine Meyer / Frank Werkmeister: Kritik der Mitbestimmung. Partnerschaft oder Klassenkampf? 4. Aufl., Frankfurt/Main: Suhrkamp 1973, S. 5f.
[33] Vgl. Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften, a.a.O., S. 113-121.
[34] Frank Deppe: Gewerkschaften unter Druck. Autonomie und außerparlamentarische Bewegung. Supplement der Zeitschrift Sozialismus 9 / 2003, Hamburg: VSA 2003, S. 31.
[35] Vgl. Phillip Becher: „Blau ist das neue Rot“. „Gewerkschaftspolitik“ bei AfD und Co., in: Marxistische Blätter, 55. Jg., Nr. 1 / 2017, S. 18-22, hier S. 19.
[36] Lelio Basso: Introduzione, in: Rosa Luxemburg: Sciopero di massa, partito, sindacati, Rom: Newton Compton 1977, S. 7-17.
[37] Vgl. Wladimir Iljitsch Lenin: Briefe. Band IV, Berlin (Ost): Dietz 1967, S. 345.
[38] Vgl. Hartmut Meine: Gewerkschaft, ja bitte! Ein Handbuch für Betriebsräte, Vertrauensleute und Aktive, Hamburg: VSA 2018, S. 43-45.
[39] Ulrike Eifler: Keine Einheit ohne politisches Mandat, 16. April 2018, online unter: https://betriebundgewerkschaft.de/blog/2018/04/keine-einheit-ohne-politisches-mandat.
[40] Karl Marx: Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen [1867], in: derselbe / Friedrich Engels: Werke. Band 16, Berlin (Ost): Dietz 1962, S. 190-199, hier S. 197.
[41] Vgl. Zoll: Der Doppelcharakter der Gewerkschaften, a.a.O., S. 106.
[42] Vgl. Karl Marx: Lohn, Preis und Profit [1865], in: derselbe / Engels: Werke. Band 16, a.a.O., S. 101-152, hier S. 152.
[43] Hierauf verweist auch Jay Arena: Only a Class Politics Can Save Us from Police Violence and Fascism: Lessons from Rosa Luxemburg and Cedric Johnson, in: Cedric Johnson: The Panthers Can’t Save Us Now. Debating Left Politics and Black Lives Matter, London / New York: Verso 2022, S. 91-99, hier S. 96.