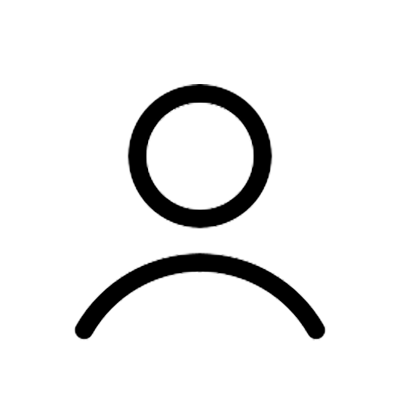Ein politisches Bündnisprojekt
Über antifaschistische Wirtschaftspolitik
Der Begriff „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ und die mit ihm verbundenen Konzepte haben seit Ende November 2024 im linken politischen Spektrum eine Diskussion ausgelöst (siehe auch nd-online.de). Die Debatte bewirkte u. a. eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Anfang Juni 2025, an der die Co-Vorsitzende unserer Partei aktiv beteiligt war. Dort bewies Ines Schwerdtner erneut ihr Interesse an Diskussionen, die auf linke gesellschaftliche Bündnisse zielen: Sie knüpft bei den Alltagssorgen der Menschen hier und heute an und nutzt aufgeschlossen Gesprächsangebote anderer linker Akteure, um politische Gemeinsamkeit zu entwickeln. Das belegt auch ihr Papier „Wirtschaft für die Mehrheit. Demokratische Kontrolle zurückgewinnen“, das sie zu Beginn des Bundestagswahlkampfes vorstellte. Darin unterbreitete sie, angeregt von Isabella Webers Drängen auf eine „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“, vor allem konkrete kurz- und mittelfristig realisierbare Vorschläge. Deren Umsetzung würde für viele Menschen soziale Erleichterung bedeuten. Dies sollte auch sozial Benachteiligte bzw. Deklassierte, von sozialen Ängsten Getriebene, von nervenraubendem Alltagsstress Gefrustete davon abhalten, der Wahl fernzubleiben oder mit einer AfD-Stimme destruktiv zu protestieren.
Damit wird keineswegs gesagt, dass vor allem in „Wahlen zu denken“ wäre und sozial Benachteiligte oder Frustrierte per se für Rechtsextremismus empfänglich seien. Ferner wird nicht gesagt, dass die Hauptakteure faschistischer Entwicklungen aus diesen Bevölkerungsgruppen hervorgehen. Auch Weber sieht die aktive Rolle von (super)reichen Kapitaleliten, (Techno)Oligarchen, Gutsituierten, Verfechtern von Austeritätspolitik für faschistische Entwicklungen. Allerdings gibt es eben auch und insbesondere unter den sozial Benachteiligten, Deklassierten und Frustrierten ein Potenzial für rechtsextreme Einstellungsmomente und Gewaltbereitschaft. Es gilt also, zugleich das politische Engagement für die soziale Absicherung, Ermöglichung und Unterstützung individueller Lebensplanung und die Förderung antifaschistischer bzw. demokratischer zivilgesellschaftlicher Aktivität zu verstärken. Damit wird auch auf eine Wirtschaftspolitik forciert, die sozial nachhaltige Entwicklung ermöglicht. Dies wiederum bedeutet keineswegs per se „Wachstumsfixierung“ oder Relativierung der ökologischen Frage. Im Gegenteil, es muss nach wie vor um sozialökologische Transformation gehen.
Dieser Beitrag wirbt dafür, die Debatte zu „Antifaschistischer Wirtschaftspolitik“ fortzusetzen und schlägt eine konkrete Initiative vor. Diese orientiert auf antifaschistische Bündnispolitik und das Interesse demokratischer Antifaschist:innen an alternativer Wirtschaftspolitik.
„Antifaschistische Wirtschaftspolitik“
Zur Erinnerung: Weber hatte den Erfolg Donald Trumps populär erklärt: Inflation und Einkommensverluste hätten bei großen Teilen der US-amerikanischen Arbeiterklasse Verunsicherung und Abstiegsängste bestärkt. Trump habe diese Sorgen mit seiner Kampagne „Make America Great Again“ nationalistisch bis faschistoid aufgegriffen und aggressiv weitergetrieben. Um nationalistischen und rechtsextremistischen Kräften aktiv zu begegnen, sei insbesondere offensiv gegen Inflation und Erwerbslosigkeit vorzugehen. So könnten Preiskontrollen und Übergewinnsteuern eingeführt werden. Eine Industriepolitik für eine grüne Wende könnte sinnvolle Arbeitsplätze schaffen. An anderer Stelle führte Weber einen streitbaren „neuen Klimapopulismus“ ein.
Weber schreibt nicht als bekennende Anhängerin von Marx und Engels oder als Sozialistin. Dennoch sind ihre Analysen fundierte Kritik der Bidenomics, wenn auch keine radikale Kritik der Biden-Politik oder der US-amerikanischen Zustände. Dennoch wären ihre Initiativen zu begrüßen und kritisch-solidarisch weiterzutreiben – ohne Vereinnahmung und Instrumentalisierung. Wer hingegen im Bemühen, Menschen mit sozialen Nöten zu helfen, vor allem fürchtet, auch nationalistisch denkende Individuen zu unterstützen, verengt die eigenen politischen Handlungsmöglichkeiten. Auch belehrende, aber folgenlose Verweise auf die entscheidende Rolle der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und des „Internationalismus in der Klasse“ stärken keinen wirksamen Antifaschismus.
Gegenwärtig wirkt bereits antifaschistisch, wenn der gesellschaftliche Alltag von mehr Menschen als demokratisch verbesserbar gewollt und gesehen wird. Aufzeigen, dass konkrete kurz- und mittelfristig realisierbare Veränderungen möglich sind, kann dem Erstarken rechtsextremer Kräfte vorbeugen und zugleich soziale und demokratische Standards gegen Angriffe von oben verteidigen helfen. Diese wachsen mit militärischer Aufrüstung und Abschottungspolitik. Argumente und praktische Angebote zur Nutzung und Stärkung sozialer Rechte sind der pragmatisch erste Ausgangs- und zugleich der Angelpunkt für „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“. Von hier aus muss darum gekämpft werden, dass soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten nachhaltig abgebaut, aber mehr soziale Sicherheit, Mitsprache und lebenswerte Perspektiven denkbar und erfahrbar werden. Es gibt sehr wohl Maßnahmen im Rahmen des Bestehenden und Bedrohten, die antifaschistisch wirken können, seien es armutsfeste Mindestlöhne, Preisregulierung, Vermögens- bzw. Reichensteuern, ein Mietpreisdeckel oder ein demokratisch zustande gekommenes öffentliches Investitionsprogramm, das auch und insbesondere Menschen in „abgehängten Regionen“ und zugleich „dem Klima“ zugutekommt. Überall wird eine Infrastruktur gebraucht, die statt an „militärischen Erfordernissen“ an sozial und ökologisch nachhaltigen Problemlösungen orientiert ist.
Unter den gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnissen wäre der Einstieg in eine „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ nur von einem gesellschaftlichen mitte-unten Bündnis durchsetzbar, obwohl die wirtschaftlichen Effekte (Kaufkraft) auch bürgerliche Ökonom:innen erfreuen dürften. Für viele unter ihnen ist Isabella Weber „links-radikal“, aber an sie kommt auch der Mainstream nicht einfach vorbei. Webers spezifische Verbindung von Maßnahmen keynesianischer Wirtschaftspolitik mit Antifaschismus geht 1. davon aus, dass neoliberale Politik die liberale Demokratie bedroht; lässt 2. ein Bündnis der wirklichen Demokrat:innen, die sowohl Faschismus als auch soziale Ausgrenzung bekämpfen wollen, als naheliegend erkennen; versucht 3. einer erstarrten Debatte (in den USA) einen Impuls zu geben, der linke und damit auch ökologische Positionen diskussionsfähig macht; kam 4. als Denkanstoß in der internationalen gesellschaftskritischen Ökonom:innen-Community an. Damit entstand eine neue Chance für Linke und Die Linke, die Schwerdtner mit ihrem politischen und kulturellen Background sofort erkannte und nutzen will.
Andere in der Linken, die schon länger dabei sind, fragen, warum nun alte Forderungen mit dem Schwerpunkt Verteidigung und Hebung sozialer und demokratischer Standards mit dem Begriff „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ verbunden werden? Sie könnten aber auch an diese Forderungen erinnern und sagen: Ihr Nicht-Umsetzen hat den politischen Einfluss rechtsextremer Kräfte noch befördert. Gut, dass es jetzt eine neue Chance für neue politische Bündnisse gibt!
Das eigentliche Problem für Viele in Der Linken besteht in zweierlei: Erstens, will eine sozialistische Partei nicht dem Status quo zu mehr Zuspruch verhelfen, sondern ihn überwinden. Nicht von ungefähr macht die Ökonomin Clara Mattei darauf aufmerksam, dass Liberalismus und Faschismus keine Gegensätze sind, sondern ein „Kontinuum“ – dass sich daher konsequent linke Politik keinesfalls zu den herrschenden Verhältnissen bekennen dürfe. Zweitens können und dürfen Sozialist:innen die Friedens- und ökologische Frage, die globalen Probleme keineswegs relativieren. Vielen aber scheint „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ nun gerade dies zu tun.
Konsequenz für Die Linke
Sich der Widersprüche und der gesellschaftspolitischen Schwäche der Linken bzw. der sozialistischen Kräfte bewusst zu sein, hilft, die vorhandenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und effektiv zu nutzen. Das kann neuen Spielraum und Einfluss eröffnen und bedeutet keinesfalls Verzicht auf Utopie bzw. Selbstbeschränkung. Die Linke und die Linken brauchen eine „Doppelbewegung“ (Uwe Fuhrmann), die offen und offensiv nach innen und außen kommuniziert. Da geht es zum einen darum, pragmatische Forderungen mit dem Fokus auf konkrete materielle Verbesserungen für die Menschen mit geringen und unteren Einkommen und ihr-Gehört-werden zu erheben und zu popularisieren. Zugleich geht es zum anderen darum, bei passenden Gelegenheiten zu betonen und daran zu erinnern, dass wir eine strukturell andere, zunehmend sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaft in einer fortschreitend zivilen, gerechten und solidarischen Gesellschaft wollen. Da können Wachstum und Profit, globale Marktanteile und militärische „Fähigkeiten“ keine Erfolgskriterien sein, sondern ausschließlich ökonomisch gesicherte demokratische, soziale und ökologische Standards für ein Leben in Würde für jeden Menschen.
Selbst bevor eine einzige der „pragmatisch“ genannten Forderungen umgesetzt sein wird, garantieren die „Doppelbewegung“ und mit ihr die Einbindung „Antifaschistischer Wirtschaftspolitik“ in die Gesamtpolitik der Linken, dass die Partei unverwechselbar ist: Sie ist eine solidarisch erfahrbare Partei, sozialistische und daher ökologische Kraft und internationalistische Friedenspartei. Die Linke betreibt „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“, indem sie die grundsätzliche soziale Unzufriedenheit aufgreift, die als individuell empfundene Nöte adressiert und deren Ursachen in den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen ausmacht, sofort Machbares fordert und entsprechend ihrer Möglichkeit realisiert und dennoch gesellschaftliche Alternativen diskutiert.
Netzwerke alternativer Ökonom:innen, Future-Gruppen, Gewerkschafter:innen, soziale, ökologische und kulturelle Zusammenschlüsse, Betroffeneninitiativen, Unterstützer:innen von Geflüchteten, Aktive in selbstorganisierten Projekten und Unternehmen und viele andere mehr beschäftigen mit Fragen und Inhalten, die nunmehr mit dem Begriff „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ gefasst werden können. Sie sollten zu einem Ratschlag zu „Antifaschistischer Wirtschaftspolitik“ zusammenkommen. Schwerdtners „Wirtschaft für die Mehrheit“ könnte ein Ausgangspunkt für die vielfältigen Diskussionen sein, die dort geführt werden könnten. Denkbar sind Beratungen und Verabredungen von Positionen und Aktivitäten gegen Armut, zur schrittweisen Schaffung einer ökonomischen Basis für öffentliche Gesundheit und Pflege bzw. für ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Nicht zuletzt könnte der Ratschlag zu politökonomischer und ökonomischer Bildung motivieren.
Die Reflektion des Ratschlages in der Partei wäre auch interessant für ihre Strategie-Debatte: Es geht um die Frage, wie sich die Partei mittelfristig aufstellt, wie sie antifaschistische Abwehrkämpfe so führen kann, dass zugleich drängende gesellschaftliche Probleme demokratisch und gerecht, solidarisch und nachhaltig angegangen werden können. So könnte ein Politikwechsel eingeleitet werden, der die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung und die Art und Weise, wie sie verläuft, endlich verändert. Der Ratschlag könnte somit zugleich interessant für die Programm-Debatte der Partei sein, denn es werden Antworten auf die Frage gesucht, was in den nächsten 10 bis 15 Jahren geleistet werden kann und muss, um auch und insbesondere mit antifaschistischer Arbeit den großen Zielen der Partei näher zu kommen.
Aber für die Beteiligung der Genoss:innen an der Vorbereitung und Durchführung eines solchen Ratschlages sollte der Ausgangsgedanke sein: Zuerst und vor allem geht es um antifaschistische Wirtschaftspolitik als Bündnispolitik!
„Auf das Wie kommt es an“ (Rosa Luxemburg).
Die Autorin dankt Uwe Fuhrmann für seinen Anteil am Zustandekommen dieses Textes.