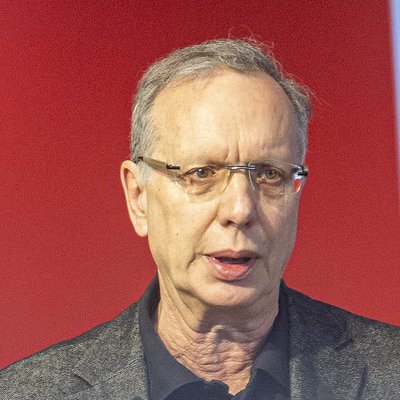Strategische Neuorientierung und ein neuer Grundkonsens
Die Probleme der LINKEN sind struktureller Natur
Neben der Union war DIE LINKE die große Verliererin der Bundestagswahl. Mit 4,9% verlor sie zwei Millionen Wähler:innen und schaffte nur mithilfe dreier Direktmandate noch den Einzug in den Bundestag. Blickt man auf das Ergebnis der Europawahlen und der letzten Landtagswahlen zurück, ist diese Entwicklung nicht völlig überraschend. 5,5% bei den Europawahlen, massive Verluste bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern waren unübersehbare Warnsignale. Mittlerweile bewegen sich die Wahlergebnisse in Ostdeutschland – mit der Ausnahme Thüringen – nur noch um die 10%. Wahlerfolge im Westen der Republik waren – bis auf Hessen – nur in den Stadtstaaten zu verzeichnen. Deshalb würde es zu kurz greifen, die Ursachen der Wahlniederlage in möglichen Fehlern im Wahlkampf oder allein in besonderen Umständen, wie etwa Polarisierung der Wahlentscheidung zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz in der Schlussphase zu suchen. Die Probleme der LINKEN sind grundlegender, struktureller Natur.
Lange Zeit konnte DIE LINKE und davor die PDS von hohen Wahlergebnissen in den ostdeutschen Bundesländern zehren. Konnte man von der PDS noch mit einigem Recht als ostdeutscher Volkspartei sprechen, sind diese Zeiten für DIE LINKE mittlerweile vorbei. Der alte – und in der Vergangenheit durchaus erfolgreiche – Slogan, wonach der Osten rot wähle, trifft schon längst nicht mehr zu. Die Profilierung der Partei als die ostdeutsche Interessenvertretung war eine Form der Identitätspolitik, die sich gegen die Abwertung ostdeutscher Biografien und die sozialen Verwerfungen und Ungerechtigkeiten im Gefolge der deutschen Vereinigung wandte. Sie war getragen von einem Milieu, das in der PDS/DIE LINKE die Partei sah, »sich ohne Demütigung mit ihrer Lebensgeschichte zu identifizieren – vielleicht auch auseinanderzusetzen«.[i] Aber diese die Partei ehemals tragenden Milieus sind – auch aus demografischen Gründen – zunehmend geschrumpft, während DIE LINKE gleichzeitig ihren Nimbus als alleinige ostdeutsche Protestpartei verlor. Das politisch diffuse, nicht inhaltlich linksorientierte Protestpotenzial findet heute in weiten Teilen ihr Ventil in der Wahl der rechtsradikalen AfD.
Das Gründungsmomentum der LINKEN, das zum Zusammenschluss von PDS und der »Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit« (WASG) führte – die Opposition gegen die Agenda-Politik der rot-grünen Bundesregierung Schröder/Fischer und Hartz IV als antineoliberale Sammlungsbewegung –, hat sich erschöpft. Es trägt nicht mehr als das zentrale, einigende Moment und Alleinstellungsmerkmal in einer veränderten politischen Situation und in neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen angesichts von Klimakatastrophe, Digitalisierung und der damit verbundenen Transformation.
Sozialdemokraten und Grüne hatten sich politisch-programmatisch neu aufgestellt. Sie forderten im Wahlkampf zwölf Euro-Mindestlohn, eine Steuerpolitik, die von oben nach unten umverteilt, eine Sicherung des Rentenniveaus und lehnten eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ab. Sie traten für eine solidarische Bürger:innenversicherung ein und versprachen Hartz IV mit einem wie auch immer gearteten Bürgergeld zu überwinden. Damit gab es große Schnittmengen zwischen den steuer- und sozialpolitischen Forderungen der LINKEN und von SPD und Grünen. Für die Wähler:innen erschienen die Unterschiede nur noch graduell. Ausschlaggebend für die Wahlentscheidung der zwischen SPD und LINKEN schwankenden Wähler:innen war weniger die Frage, ob der Mindestlohn 12 oder 13 Euro beträgt, sondern welchen Parteien zugetraut wird, einen höheren Mindestlohn durchzusetzen. Ein immer wiederkehrender Befund in Umfragen lautet, dass DIE LINKE zwar den Finger in die Wunde legt, aber keine Probleme löst. Die Probleme zu benennen und die richtigen Forderungen zu stellen, reicht nicht mehr.
Alban Werner stellt zutreffend fest, dass in der Ära Merkel »Wahlen die längste Zeit unter einem ›Schleier der Folgenlosigkeit‹ stattfanden. Mit Ausnahme des kurzlebigen Hypes um Martin Schulz wurde keinem der SPD-Herausforderer ernsthaft zugetraut, die Kanzlerin politisch bezwingen zu können.«[ii] Für DIE LINKE zu stimmen, erschien daher weitgehend als »risikolos«, war keine »verschenkte Stimme«. In dem Moment aber, als im Wahlkampf die Möglichkeit aufschien, dass die SPD stärkste Partei wird, wurde die Frage der politischen Durchsetzungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der LINKEN zu einem zentralen Thema.
DIE LINKE reagierte darauf, indem sie verstärkt ihren Regierungswillen deutlich machte und darauf hinwies, dass nur in einer Regierung mit der LINKEN soziale und ökologische Reformen möglich seien, und dass in einer Ampelkoalition wesentliche Forderungen von SPD und Grünen auf der Strecke bleiben werden. Dies war grundsätzlich richtig. Aber eine Partei, die als zerstritten gilt und in der wichtige Akteur:innen öffentlich sich widersprechende Positionen vertreten, ist für viele Wähler:innen eben kein attraktives und wählbares Angebot, der man die Regierung eines Landes anvertrauen will. Das uneinheitliche Abstimmungsverhalten der Bundestagsfraktion zum Afghanistan-Mandat bestätigte den Eindruck, dass in entscheidenden Fragen auf DIE LINKE kein Verlass ist.
Die Diskussion über eine rot-rot-grüne Reformkoalition konnte so keine Dynamik entfalten. Im Gegenteil – SPD und Grüne fürchteten eine damit verbundene Polarisierung und forderten im Wissen darum, dass die Forderung nach Auflösung der NATO im linken Wähler:innenpotenzial höchst umstritten ist, ein Bekenntnis zur NATO, um eine rot-rot-grüne Perspektive zu diskreditieren und DIE LINKE zu schwächen.
Die Bundestagswahl machte damit auch deutlich: Es reicht nicht aus, sich sozialer als SPD und Grüne profilieren zu wollen. Zu Zeiten der Agendapolitik konnte sich DIE LINKE als grundlegende Alternative zur neoliberalen Politik positionieren und damit erfolgreich Wähler:innen mobilisieren. Angesichts einer Sozialdemokratie und einer grünen Partei, die sich sozialer aufstellten, erschien DIE LINKE als Partei, die nur noch etwas mehr will als SPD und Grüne: einen höheren Mindestlohn als SPD und Grüne, einen höheren Spitzensteuersatz und eine höhere Vermögenssteuer, ein höheres Rentenniveau …
In diesem Wahlkampf hätte es aber um mehr gehen müssen. Wir stehen gegenwärtig an einem Wendepunkt der kapitalistischen Entwicklung. Das neoliberale Akkumulationsmodell ist mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 an seine Grenzen gestoßen und hängt nur noch am Tropf der Notenbanken. Die sich immer deutlicher abzeichnenden und erlebbaren katastrophalen Folgen der Klimakrise erfordern einen Ausstieg aus dem fossilen Kapitalismus – den »größten Umbauprozess der Industrie sei 100 Jahren«, wie Olaf Scholz es formulierte. Die kommende Periode wird von einem Ringen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfte um die Ausgestaltung dieser Transformation, neuer Formen der Regulation und ein neues Akkumulationsregime bestimmt sein. Auch die entscheidenden Kapitalfraktionen fordern mittlerweile eine aktive und regulierende Rolle des Staates, wenn z.B. BDI und DGB gemeinsam umfassende öffentliche Investitionen fordern oder in einem von vielen Großunternehmen unterzeichneten Aufruf gefordert wird, »die Transformation zur Klimaneutralität zum zentralen Wirtschaftsprojekt der kommenden Legislaturperiode zu machen«.[iii]
Der notwendige sozial-ökologische Umbau war ein zentrales Thema im Wahlprogramm der LINKEN. Dies war das Ergebnis einer längeren Diskussion über einen »Green New Deal« und einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Die erzielten politisch-inhaltlichen und programmatischen Fortschritte waren und sind trotzdem nicht profilbestimmend für die Partei und ihr öffentliches Erscheinungsbild. Auch in der Wahlkampagne der LINKEN spielte das Thema Klimagerechtigkeit und die notwendige Transformation nicht die Rolle, die ihr eigentlich hätte zukommen müssen. Zu oft erschien DIE LINKE nicht als aktiver Treiber der notwendigen sozial-ökologischen Umgestaltung und Nachhaltigkeitsrevolution. Viele Akteure agierten eher defensiv, die Partei erschien vor allem als sozialer Reparaturbetrieb – eine Funktion, die für viele die SPD besser erfüllen kann.
Und dass DIE LINKE eine halbe Million Wähler:innenstimmen an die Grünen verloren hat, und die Grünen wachsende Zustimmung unter Gewerkschaftsmitgliedern verzeichnen können, liegt nicht daran, dass DIE LINKE in ihrer Politik »zu grün« war, sondern dass man den Grünen eher zutraute, die anstehende Transformation zu gestalten und zu bewältigen. Umfragen, bei denen die Aussage »Es ist nicht klar, wofür DIE LINKE steht« hohe Zustimmung erfährt, machen deutlich wo das Problem der LINKEN liegt: Es fehlt gegenwärtig an einer gemeinsamen, verbindenden strategischen Orientierung, einem gemeinsamen linken Narrativ in einer gegenüber der Gründungsphase veränderten politischen und gesellschaftlichen Situation. Und auch der von dem britischen Wirtschaftshistoriker Adam Tooze in seinem Buch »Die Welt im Lockdown« herausgearbeitete Aspekt zu den Folgen der Covid-19-Pandemie, dass »es in der Geschichte des modernen Kapitalismus [...] noch nie einen Moment gegeben [hat], in dem fast 95% der Volkswirtschaften auf der Welt gleichzeitig einen Rückgang des Pro-Kopf-BIP zu verkraften hatten, wie es in der ersten Hälfte des Jahres 2020 der Fall war«,[iv] spielte in den strategischen Überlegungen der Partei keine Rolle.
Diese Defizite zu überwinden, muss eine zentrale Aufgabe bei der strategischen Neubestimmung der Politik der LINKEN sein. Allein darauf zu setzen, dass die kommende Ampelkoalition einen großen Teil der sozialen Wahlkampfversprechen von SPD und Grünen nicht umsetzen wird, wäre zu kurz gesprungen. Die Ampelkoalition wird absehbar versuchen, die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft und die Digitalisierung als gesellschaftliches Modernisierungsprojekt zu kommunizieren. Die Rhetorik von der »Fortschrittskoalition« und vom »Aufbruch« macht deutlich, mit welchem Framing und welcher Erzählung diese Politik begleitet werden soll. Dies wird mit Fortschritten in gesellschaftspolitischen Fragen verbunden sein – wie z. B. der Ermöglichung eines »Spurwechsels« in der Flüchtlings- und Migrationspolitik, wie einer Streichung des § 219a und der Entkriminalisierung von Cannabis. Es sollte nicht unterschätzt werden, dass hiervon eine gewisse Attraktionskraft ausgeht und das sich hier neue gesellschaftliche Allianzen bilden können.
Gleichzeitig sind die Grenzen dieser Politik der künftigen Koalition offensichtlich. Bereits im Sondierungspapier hat die FDP hier klare Grenzen mit der Absage an jede Steuererhöhung und Umverteilung gezogen. Die Nachhaltigkeitsziele sollen vor allem über den Markt durch CO2-Bepreisung und technologische Innovationen, flankiert mit etwas Ordnungsrecht, erreicht werden. Damit wird zwar eine begrenzte ökologische Modernisierung, nicht aber das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens möglich sein. Ein Umstieg vom Verbrenner zur E-Mobilität bedeutet noch keine sozial-ökologische Verkehrswende. Zwar wird die Antriebstechnik gewechselt, aber ein Abschied von einer Verkehrspolitik, die prioritär auf das private Auto setzt, ist damit nicht verbunden. Dies bedeutet weiter einen massiven Ressourcenverbrauch und wachsenden Bedarf an erneuerbarer Energie.
Der Ausbau der Bahn, ihre Stärkung in der Fläche durch Wiederinbetriebnahme ehemals stillgelegter Strecken und die notwendige Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene bedarf massiver öffentlicher Investitionen. Gleiches gilt für die Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs in den Städten und Gemeinden. Die »Hebelung privater Investitionen« (Robert Habeck) z.B. durch KfW-Förderung oder – wie es im Sondierungspapier heißt – »Superabschreibungen« kann eine ökologische Modernisierung von Industrieproduktion befördern, bricht aber nicht mit der kapitalistischen Logik des steigenden Absatzzwangs. Die Transformation vor allem über einen steigenden CO2-Preis wird mit sozialen Ungerechtigkeiten verbunden sein, wenn keine Alternativen – z.B. für Pendler:innen vom Land in die Stadt – bestehen. Die Möglichkeiten, dem erhöhten CO2-Preis auszuweichen, sind ungleich verteilt und vor allem: Wer ein ausreichend hohes Einkommen hat, wird sich auch weiterhin ein klimaschädliches Konsumverhalten leisten können.
Auch im Transformationskonzept der Ampel sind hohe öffentliche Investitionen erforderlich – in öffentliche Infrastruktur, die Förderung von Forschung wie privater Investitionen usw. Nicht umsonst fordern Arbeitergeberverbände höhere staatliche Investitionsausgaben. Mit dem steuerpolitischen Dogmatismus der FDP und dem Bekenntnis zur Schuldenbremse und dem europäischen Fiskalpakt hat sich die Ampel finanzpolitisch selbst enge Fesseln angelegt.
DIE LINKE muss den Kampf für einen sozial-ökologischen Systemwechsel zu ihrem zentralen, profilbestimmenden Thema, und die Alternative zum Konzept der markt- und technologiegetriebenen Transformation deutlich machen: klare Vorgaben und Regulierung für den Umbau von Industrie und Wirtschaft, soziale Garantien für Einkommen und Beschäftigung in der Transformation und Wirtschaftsdemokratie durch Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung sowie Transformations- und Wirtschafts- und Sozialräte. Stärkung der Tarifbindung, gute Arbeit und eine Stärkung des Öffentlichen, öffentliche Investitionen in das Gesundheitssystem, die soziale Infrastruktur und das Verkehrswesen sind dafür wesentliche Pfeiler. Im Gesundheitswesen muss es wie in der Bahnpolitik und der Mietenpolitik um Orientierung am Gemeinwohl und Nachhaltigkeit statt Profitorientierung und Wettbewerb gehen. Zur Nachhaltigkeit gehört auch eine Überwindung der Zwei-Klassen-Medizin durch eine solidarische Bürger:innenversicherung und eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Dies ist mehr als eine gelegentlich geforderte »Rückbesinnung auf die soziale Kernkompetenz« der LINKEN. Und die Finanz- und Steuerpolitik muss den immensen privaten Reichtum abschöpfen und in den sozial-ökologischen Umbau investieren. Es muss um einen grundlegenden Wandel der Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensweise gehen, eine sozial-ökologische Industrie- und Strukturpolitik – kurz um das aktive Vorantreiben einer sozial-ökologischen Transformation.
Voraussetzung aber ist, dass DIE LINKE einen neuen Grundkonsens findet, und ihre politische Funktion unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen neu definiert. Der gegenwärtige dissonante Chor aus der Partei, der zu den Fragen Klimaschutz, Migration, Pandemiebekämpfung bis hin zur Haltung gegenüber autoritären Regimen die unterschiedlichsten Positionen vertritt, muss einer gemeinsamen Position in den wesentlichen Grundfragen weichen. Das gegeneinander Ausspielen unterschiedlicher Milieus ist destruktiv und schädlich. Stattdessen gilt es, die gemeinsamen Interessen hervorzuheben. Dies setzt aber auch voraus, zugleich unterschiedliche Lebenslagen, kulturelle Orientierungen und Bindungen zur Kenntnis zu nehmen. Ein Ausstieg aus der Kohle hat in den Braunkohlerevieren für die Betroffenen eine andere Bedeutung als im großstädtischen Bewegungsmilieu. Und Verkehrswende auf dem Land mit einer kaputtgesparten Infrastruktur ist etwas anders als Verkehrswende in einer Großstadt. Die Beschäftigten in der Automobilindustrie haben ein Interesse an einem gesicherten Arbeitsplatz und Einkommen, dies ist aber kein Argument gegen die notwendige Transformation, sondern für Beschäftigungs- und Einkommensgarantieren als Voraussetzung einer gelingenden Transformation.
Diese Unterschiede müssen in der Politik, der Kommunikation und der Ansprache berücksichtigt werden, dabei muss jedoch immer das Verbindende, das gemeinsame Interesse artikuliert werden, statt zu spalten. Es ist unbestreitbar, dass die anstehende Transformation mit vielen Befürchtungen und Abstiegsängsten verbunden ist. Dies gilt nicht nur für den Osten Deutschlands, wo für viele die Erfahrungen mit der Transformation im Gefolge der Vereinigung mit traumatischen Erfahrungen verbunden war. Die Antwort darauf kann aber nur das Eintreten für soziale Garantien, für eine sozial-ökologische Strukturpolitik und die Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung über Transformations- und Wirtschafts- und Sozialräte sein. Und für eine emanzipatorische LINKE sollte es ebenso zur Selbstverständlichkeit gehören, dass Identitätspolitik und Klassenpolitik keinen Gegensatz bilden.
Der nächste Bundesparteitag im Sommer 2022 muss sich diesen Fragen stellen und eine strategische Neuorientierung der Partei und einen neuen Grundkonsens formulieren. Pluralismus kann nicht Beliebigkeit bedeuten, die Vielfalt der Partei muss sich innerhalb eines Grundkonsenses bewegen, nur dann kann Pluralismus produktiv gemacht werden. Notwendig ist auch die Überwindung des bisherigen Dualismus von Parteivorstand und Fraktion, des unabgestimmten Nebeneinanders mit der Gefahr zu einem Gegeneinander zu werden. DIE LINKE muss wieder zu einer Partei mit klar erkennbarer politischer Position, Durchsetzungswillen und gewachsener Kompetenz werden.
Der Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift Sozialismus. Wir danken für die Möglichkeit zur Veröffentlichung.
[i] Rainer Land/Ralf Possekel, PDS und moderner Sozialismus, in: Michael Brie/Martin Herzig/Thomas Koch (Hrsg.), Die PDS. Empirische Befunde und kontroverse Analysen, Köln 1995, S. 113
[ii] Alban Werner, Die Talfahrt der LINKEN, Jacobin 1.10.2021, jacobin.de/artikel/die-talfahrt-der-linken-linkspartei-bundestagswahl/.
[iii] https://www.stiftung2grad.de/umsetzungsoffensive-klimaneutralitaet-7176.
[iv] Zitiert nach Joachim Bischoff, »2020: Krisenjahr des Neoliberalismus«, in Sozialismus.de, Heft 11-2021, S. 33.