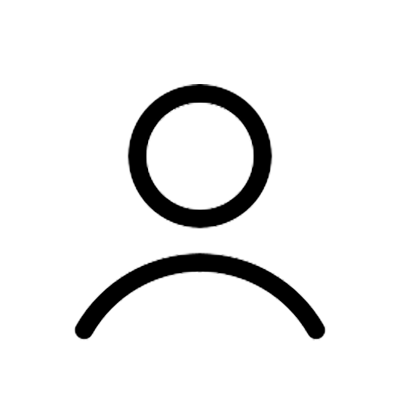Die Kränkungen des Lothar Bisky
Eine politisch-psychologische Spurensuche
„Am Anfang war die Kränkung. Kein Streit, kaum ein Konflikt und nur wenige Krisen, die nicht auf Kränkungen zurückzuführen sind. Kränkungen trüben das Lebensglück, lösen mannigfaches Leid aus, stoßen den Menschen in Bitternis und bestimmen viele Schicksale. Nichts beeinflusst Stimmung und Motivation, nichts Befindlichkeit und Lebensqualität, nichts unser Selbstwertgefühl so sehr wie manche Kränkung.“
Reinhard Haller, Die Macht der Kränkung, Ecowin Verlag 2015, S.9
Zwei Dinge waren es, die den Weg Lothar Biskys und seinen Charakter von Kindheit an bestimmt und geprägt haben: Seine plebejische Herkunft und die früh erfahrenen Kränkungen. Beides fällt nur zeitlich zusammen. Wohl galten die Kränkungen in Brekendorf, Schleswig-Holstein, nach langer Flucht, zweimal von der Front eingeholt und überrollt, wo er 1947 ankam, aus Hinterpommern geflohen, dem Habenichts, vor allen aber dem Fremden, den man nicht willkommen heißen mochte.
Wie Lothar Bisky damit, mit seiner Herkunft wie mit den Kränkungen, umzugehen gelernt hatte, darüber wird zu reden sein. Die Traumata, durch Kriegserlebnisse und Gewaltexzesse, die er auf dem Treck, der Flucht aus Hinterpommern nach Holstein, ansehen musste, sind im Hintergrund mitzudenken, werden hier aber nicht behandelt.
Seine Herkunft prägte ihn und seine politischen Ansichten
Lothar Bisky, Jahrgang 1941, gestorben 2013, war ein hoch reflexiver Mensch. Texte und Gespräche, aber auch sein Verhalten, bis in die Politik hinein, zeugen von einer sehr genauen Kenntnis der eigenen Person. Das sind dann die Referenzen für diese kleine politisch-psychologische Charakterstudie. Der Autor durfte viele Jahre als Mitarbeiter und Redenschreiber seinen Chef aus der Nähe beobachten. Auch das fließt in die Studie ein.
„Zu Hause fühlte ich mich eigentlich nur im Arme-Leute-Milieu. Im Milieu der Intelligenz – ob Ost oder West – habe ich lange Jahre keine Heimat gefunden. Eine heimliche Neigung für plebejische Kultur ist mir geblieben.“ (SvT S.70) Dieses Bewusstsein der Herkunft scheint kulturell vererbt, an anderer Stelle erzählt Bisky von seinem Onkel Hans, der als Einziger der Familie Abitur gemacht hatte und aufgestiegen war. „Zweifellos war er einer der Ihren, aber er gehörte nicht mehr zu ihrer Welt.“ (ebd. S.17) Bisky hatte beide Perspektiven verinnerlicht, die aus seiner Welt auf „die da Oben“ und von oben auf seine Welt, aus der er es ihn herausgetrieben hatte.
Interessant ist sein Begriff der „heimlichen Neigung für plebejische Kultur“. Von einem, wie man früher schrieb, „Schulmann“ aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Constantin Matthiae, wird immer mal wieder ein Zitat kolportiert: „Je lebendiger der Trieb zum höheren wissenschaftlichen Leben, desto geringer der Hang zum Niederen.“ Dieser Trieb war Bisky wohl stark eigen, er führte ihn nach oben und, was als Verlust lebendig blieb, weg von denen, bei denen er sich heimisch fühlte, von „meinen Leuten.“ (ebd. S. 70) Der „Hang zum Niederen“, ihn lebte Bisky verschiedentlich und dann wohl auch selbstbewusst aus, in seinen Essgewohnheiten, seiner Markentreue beim Rauchen, es musste die „Karo“ sein. Interessanter noch scheint sein plebejisch geprägtes Verhältnis zur Arbeit zu sein.
Harte Arbeit
Wenn Bisky über sich und seine Arbeiten spricht, dann sind das nicht zuerst seine wissenschaftlichen Texte. Maloche, Schufterei, schwere körperliche Arbeit, davon ist die Rede. Natürlich, arbeiten hatte Bisky bereits als Kind müssen, erst daheim, auf dem Lande, der Familie helfend. Das war normal. Bemerkenswert scheint, wie in Biskys Schilderungen Perioden harter körperlicher Arbeit ungewöhnlich Raum einnehmen. Das war ihm wohl wichtig. Bisky wollte in Leipzig studieren, das Aufnahmegespräch endete damit, dass man ihm nahelegte, ein Jahr in der Produktion, bei der Arbeiterklasse, Erfahrungen zu sammeln und dann sein Glück erneut zu versuchen. Es verschlug ihn in ein Blechverformungswerk in Leipzig. An einer Schrottpresse trug er viele Blessuren davon. (SvT, S. 50f.) An der Schilderung ist interessant, dass Bisky umgehend feststellte, dass er mit exzessiver Arbeit den Lohn steigern konnte und dies dann auch tat. Dasselbe Muster kehrt in dem Bericht von seiner Arbeit in Buna wieder, wo er Kalksäcke temporeich in Eisenbahnwaggons verlud und trotz der Hautverätzungen stolz sein Einkommen steigerte. (SvT, S. 67f.) Dann in dem merkwürdig ausführlich geratenen Bericht von seinem Ernteeinsatz 1964 auf den Kartoffelfeldern, wo er in einen wahren Sammelrausch verfiel und alle Rekorde der „Kartoffellese“ brach, Prämien einheimste und am Ende zu den Besten der DDR zählte und ausgezeichnet wurde. (SvT, S. 71ff.)
Das war nicht das Verhältnis eines klassischen, gewerkschaftlich organisierten Industriearbeiters zu seiner Arbeit. Der arbeitete, soviel er musste, nicht mehr. Auch in der DDR waren „Helden der Arbeit“ in den Betrieben eher verhasst. Das ist plebejisches Erbe, für sich zu rackern, Geld zu machen, um sich was leisten zu können. So ist die eine Form des Arbeitens, das Lernen, Studieren und wissenschaftlich Arbeiten der Weg aus seinem Milieu heraus, die andere Form, der körperliche Exzess zum Zwecke des Geldverdienens, eine, die ihn innerlich in seinem Herkunftsmilieu verbleiben ließ. Nicht ganz nebenbei: Wohl hatte Bisky als Jugendlicher das „Kommunistische Manifest“ gelesen, die Mentalität der deutschen „klassenbewussten“ Arbeiterschaft blieb ihm wohl zeitlebens eher fremd, was, als die WASG, eine Ansammlung von Gewerkschaftsfunktionären, auf die PDS übergriff, ihn sehr umtrieb. Die Abneigung war beiderseits herkunftsbedingt.
Die Kränkungen der Kindheit
Wind. Gern wird die Sehnsucht Lothar Biskys nach dem Wind Holsteins erinnert. Er selbst hat immer wieder das Thema Wind ins Spiel gebracht. „Ich habe den Wind von Holstein vermißt und immer sehr an Holstein gehangen, obwohl ich dort nicht geboren bin.“ Und er sagte „daß ich noch jahrelang in Sachsen rausgerannt bin, wenn der Wind kam. Alles zog sich entsetzt in die Zimmer zurück, und ich bin rausgerannt, mit einem Gefühl, als müsse ich mich befreien.“ (ST, S.10)
Das Gefühl trog Bisky sicher nicht. Die Zeit in Holstein war eine Zeit voller Kränkungen, seitenlang berichtete Bisky darüber. Sich in den Wind zu stellen war eine gute Art, Kränkungen zu verarbeiten. Therapeuten empfehlen es als „Körperöffnung“: „Wenn Sie eine Kränkung tief in sich spüren, gehen Sie erst einmal kurz vor die Tür. Atmen Sie durch und füllen Sie Ihren Brustkorb mit so viel Luft, wie es geht. Richten Sie sich dabei auf, schauen Sie nach vorne oben. Sie können sich auch recken und strecken.“ (Unkraut S. 2) Wir sehen Lothar Bisky vor uns, in Brekendorf und in Sachsen.
Der Kränkungen waren viele in Biskys Kindheit. Die Mutter wurde nach ihrer Scheidung von den Einheimischen wüst beschimpft, sie war eine Art Freiwild (alles O-Ton LB). Die Bauern beuteten die Mutter, den Bruder aus. Die Kinder der Einheimischen taten das Übrige mit dem „armen Pack“. Das „Almosenverhalten, wenn man zu Leuten ging, die mit mir zur Schule gingen und reiche Eltern hatten. Das hat mich immer sehr gekränkt.“ (ST, S.24) Bisky wollte raus da, nur weg: „Ich will raus aus solchen Verhältnissen der Kränkung.“ (ebd. S. 25). Und: „Ich wollte nur in eine andere interessante Welt, in der es diese blödsinnige Kränkung von Menschen nicht gibt.“ (ebd. S.27)
Der Psychologe Kurt Lewin, Begründer der „Feldtheorie“, zeigte, dass in starken Konflikten der Person die Möglichkeit bleibt, auszuweichen, „aus dem Felde zu gehen“. Lothar Bisky hat von dieser Möglichkeit verschiedentlich Gebrauch gemacht, nicht nur im Umgang mit Kränkungen.
Kränkungen in der DDR
Von denen wird von Lothar Bisky wenig berichtet. Hier war er den „Verhältnissen der Kränkung erst einmal entkommen. Hier folgte er seinem „Trieb zum höheren wissenschaftlichen Leben“, lernte, studierte, gründete eine Familie, stieg auf. Heimisch wurde er dabei lange nicht. Aber er hatte ja auch gelernt, mit Kränkungen produktiv umzugehen. Exemplarisch sei ein Beispiel genannt: Die bereits erwähnte Absage des Studienplatzes in Leipzig und das „Ab in die Produktion!“ empfand Bisky insofern als Kränkung, weil er doch mit dem Kopf arbeiten wollte (also raus aus dem plebejischen Milieu). „Aber das war für mich auch keine Strafe. Da hab ich mich dann durchgeschlagen.“ (ST, S.32)
Schwere körperliche Arbeit, das dürfte auch eine Art der Bewältigung von Kränkungen sein. (Nebenbei könnte man auf den Gedanken kommen, dass die kommunistischen Funktionäre, die diese Maßnahmen, zumeist für Kopfarbeiter, verordneten, um diesen psychologischen Effekt wussten.)
Die finale Mülltonne der Partei
Seinen Entschluss, sich an die statuarische Amtszeitbegrenzung von 8 Jahren zu halten und 2000 aus dem Amt des Parteivorsitzenden regulär auszuscheiden, hatte weitere Gründe: „Nicht zuletzt fühlte ich mich ausgebrannt. Immer wieder hatte ich als Vermittler gegen eine Vielzahl von Polarisierern die Partei zusammenhalten müssen, damit sie nicht zersplitterte und in die Bedeutungslosigkeit abtauchte. Alle Beschwerden landeten letztlich bei mir, alle schwierigen Fälle und Probleme sowieso. Ich fühlte mich als die finale Mülltonne der Partei.“ (SvT, S.268)
Die seelische Leistung Biskys, in diesen knappen Worten notiert, wird erst deutlich, wenn man bedenkt, welche Utopie er von Kindheit an träumte. Seine Mutter hatte, nach der Trennung von ihrem Mann, mit einem Kriegskameraden desselben zusammengelebt. Darüber berichtete Bisky: „Übrigens, das einzige Verhältnis zwischen Menschen, was ich kenne, wo es nie Streit gab, was mich damals sehr berührt hat und was ich heute noch phantastisch finde.“ (ST, S. 17) Und, ebenfalls 1995, beschrieb er sein Utopia: „Da ist eine Insel, auf der man neu beginnen kann, unter Härten, unter Schwierigkeiten, aber mit gegenseitigem menschlichem Respekt, mit Ackerbau und dem Versuch, etwas neu zu machen. Das wäre mein Hauptwunsch.“ (ST, S. 118).
Man muss das ernst nehmen, will man Lothar Bisky als Mensch, als Wissenschaftler und als Politiker nahekommen. Als Mensch mied er Konflikte, als Kultur- und Kommunikationssoziologe analysierte er die Praxen der Unkultur und als Politiker, vor allem als Parteivorsitzender, beklagte er die Praxis der von ihm so genannten „denunziatorischen Kommunikation“, diese linke Kultur der systematischen Kränkungen untereinander.
Allerdings bedarf dies einer Ergänzung. Bisky hatte einen klaren Blick auf Situationen, wo einem Konflikt darum nicht auszuweichen war, weil er für Menschen in seiner Verantwortung existentiell werden konnte. Bekannt sind die Fälle aus seiner Zeit als Rektor der HFF Potsdam-Babelsberg, wo er sich vor seine Studenten stellte, wenn ihnen Zensur und Schlimmeres drohte. (Schätzte er die Folgen eines eigenen Ausweichens für Dritte als nicht existentiell ein, ging er schon auch „aus dem Felde“, etwa im Konflikt mit Oskar Lafontaine um enge Mitarbeiter, die dem Saarländer kritisch gegenüberstanden.)
Wieso suchten die Rechthaber und Denunzianten seine Nähe?
Es ist eine interessante Frage, wieso all diese Rechthaber und Denunzianten gerade zu Lothar Bisky gekommen sind. Was qualifizierte ihn als „finale Mülltonne“? Woran erkannten sie diese Qualität? Wer derartige Situationen miterleben konnte, der weiß: Bisky hörte sich das alles stoisch an. Er ließ sich nicht auf die Anwürfe ein. Ergriff nicht selbst Partei, was sicher alles bei Gregor Gysi exakt anders lief. Wie die Stoiker hatte er diesen Blick: Du tust mir leid, so, wie du dich gerade durch dein Reden selbst schädigst, erniedrigst, gegen die menschliche Natur, zum Guten zu streben, handelst.
Bisky war, wenn man so will, ein mitleidiger Mensch. Er sah dem Gegenüber in die verletzte Seele und war doch hilflos. Hatte er gelernt, mit Kränkungen umzugehen, so war er mit Leuten konfrontiert, denen das nicht gegeben war. Er selbst, Bisky, hatte die Technik, die Therapeuten „De-Zentrierung“ nennen, früh gelernt, zu reflektieren, dass andere durch etwas gekränkt sein können, was man selbst überhaupt nicht als kränkend empfindet. Es war dann nur einfach Überlastung für ihn.
Ross und Reiter nennen
Anfang des Jahres 1995 rang die Partei PDS um ihre programmatische Ausrichtung, ein Fünf-Punkte-Programm, das Bisky mittrug, erwähnte erstmals die Option, unter Umständen über eine Tolerierung oder eine Regierungsbeteiligung nachzudenken. Das rief prominente „ideologische Wächter“, „prominente Wissenschaftler und Kulturleute aus der PDS und ihrem Umfeld“ (SvT, S.266) auf den Plan. Die witterten Verrat und veröffentlichten einen Brief mit dem Titel: „In großer Sorge“. Lothar Bisky war über den Ton des Briefs schwer empört. Zu einer öffentlichen Reaktion, in der gleichen Ausgabe des „ND“, mussten wir ihn allerdings geradezu nötigen, er wehrte sich buchstäblich mit Händen und Füßen dagegen. Dann aber gab er nach und es erschien folgender Text:
Roß und Reiter nennen!
In der Erklärung „In großer Sorge" wird die Behauptung aufgestellt, irgend jemand in der PDS hätte leichtfertig und unbegründet eine gefährliche Richtungsänderung der Partei vorgenommen. Irgend jemand hätte den Grundkonsens der Partei in drei Fragen aufgekündigt. Damit hätte dieser Jemand die Entwicklungsgrundlagen der
Partei untergraben.
Ich stelle dazu folgende Fragen:
1. Wer hat „eine gespenstische Schlacht in den eigenen Reihen unter der absurden Losung 'Reformer gegen Stalinisten' eingeleitet"?
2. Wer hat den Grundkonsens der PDS aufgekündigt?
3. Wer geht den „Weg der Anpassung"? Als Vorsitzender der PDS fühle ich mich, solange niemand sonst mit Namen genannt wird, persönlich angesprochen. Ich weise diese Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Wenn irgend etwas dieser Partei den Todesstoß versetzen kann, dann ist es die historische Wiederbelebung dieser Art von Denunziation und politischem Rufmord, bei dem weder Roß noch Reiter genannt werden. Mein Respekt vor den Unterzeichnenden läßt mich trotz aller Sorge hoffen, daß wir den Weg
zum politischen Dialog finden werden. (ND, 27./28. Mai 1995, S. 3)
Lothar Bisky ahnte, dass seine öffentliche Zurückweisung des Vorwurfs des Verrats ihm einen weiteren Shitstorm einbringen würde und so kam es auch. Darunter litt er wahrscheinlich mehr als unter der Denunziation durch eine Handvoll linker Intellektueller. In seiner Autobiographie zitiert er den großen polnischen Aphoristiker Kazimierz Brandys mit dem Spruch: Wenn einer dich öffentlich ein Schwein nennt, versuche nicht, es zu widerlegen. Es kann dir nicht gelingen. (SvT, S.226) Eine uralte seelische Technik, mit Verletzungen und Kränkungen umzugehen. Lothar Bisky hatte sie gelernt, jene, die ihn zumüllten, nicht.
Bisky und seine Freunde
Hier ist der Platz, auf das Thema „Bisky und seine Freunde“ einzugehen. Alltagserfahrung und therapeutisches Wissen über Kränkungen zugleich ist: Je wichtiger eine Person für mich ist, desto eher kann sie mich kränken. Bisky beschrieb seine Auffassung von Freundschaft in dem Interviewband „So tief bücke ich mich nicht“ recht gut. Nach der Wende gab es „auch neue Freundschaften. Für mich ist schon anregend, daß Menschen kommen, wenn ich im Lande unterwegs bin, die mir ihr Leben erzählen. Es sind manchmal – bei Gott – sehr komplizierte Lebensschicksale. Dennoch haben diese Leute das Vertrauen zu mir, wir sprechen über ihr Leben, und daraus entwickeln sich neue Beziehungen und auch neue Bekanntschaften. Freundschaften sollte man nicht gleich sagen, aber doch eine Menge neuer Bekanntschaften. Das macht mich eigentlich ganz froh.“ (ST, S. 103)
Bekanntschaften als eine Vorstufe von Freundschaften. Menschen haben Vertrauen zu mir. Fasse ich dann auch Vertrauen zu ihnen, wird es Freundschaft. Der springende Punkt ist der aktive Vorgang, Vertrauen zum Gegenüber zu fassen, diese Nähe zuzulassen, eine Person wichtig für mich werden zu lassen. Das Risiko, Kränkung zu erfahren, bewusst in Kauf zu nehmen.
Es gibt in der Autobiographie zwei Episoden, bei denen man sich fragt, warum Bisky sie erzählt. Die Geschehnisse müssen ihm sehr wichtig gewesen sein, seelisch. Die eine Geschichte ist die vom Herrn W.. Biskys lernten ihn Ende der 60er Jahre in Leipzig kennen. Er war Kaderchef der LDPD, also eine Vertrauensperson. Es entwickelte sich eine „gutnachbarschaftliche Beziehung“, man besuchte sich auf ein „Gläschen Wein“. Der Mann versprach, bei der Beschaffung einer besseren Wohnung zu helfen – am Ende ein notorisch krimineller Betrüger, der die Biskys um viel Geld brachte, geliehen zum großen Teil. SvT, S. 89f)
Die andere Geschichte ist die von der „Troika“, den drei prägenden Gestalten der Brandenburger PDS: Michael Schumann, Heinz Vietze und Lothar Bisky. Unter widrigen Umständen stimmten Vietze und Schumann in der Brandenburger Landtagsfraktion für einen anderen Kandidaten für das Amt des Verfassungsrichters. „Eigentlich eine Bagatelle…Sie beide und auch andere Freunde aus der Fraktion litten mehr unter diesem Konflikt als ich.“ (SvT, S.232f.)
Eine Bagatelle? Im einen wie im andern Falle wohl nicht. Bisky beschreibt in beiden Episoden, wie sein Gewähren von Vertrauen, das Zulassen von Nähe, zu Kränkungen führte. In beiden Fällen versuchte er sich mit nachträglichen Einordnungen. So gründlich wäre wohl die Auswahl der Funktionäre in der DDR dann doch nicht gewesen, meinte er in Bezug auf den Herrn W., im Falle der Troika lebte Bisky sich „durch diese Erfahrung in die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln parlamentarischer Demokratie ein, die mit den Unterwürfigkeitsadressen, Stammesritualen wie dem Fraktionszwang und anderen vordemokratischen Gewissheiten nur so gespickt ist.“ (ebd.)
Freundschaften zu schließen, andern Vertrauen zu gewähren, blieb für ihn ein riskantes Unterfangen. Freundschafts-Freunde und Bekanntschafts-Freunde zu unterscheiden war wichtig, Lothar Bisky, der Monolith, der Erfahrene, Stabile, war ein sensibler Mensch.
Bundestag - viermal in die Fresse
Zur Vorgeschichte dieses dramatischen Vorgangs, dieser großen Kränkung, gehört, daran zu erinnern, dass Lothar Bisky 1994 das skandalöse Verhalten eines Großteils der Abgeordneten des neu gewählten Deutschen Bundestages während der Eröffnungsrede des Alterspräsidenten Stefan Heym, eines weltbekannten Schriftstellers und Antifaschisten, über die Liste der PDS gewählt, erleben musste. Erst versuchte man, die Rede zu verhindern, dann verweigerte man den Applaus und endlich wurde die Rede zunächst auch nicht im „Bulletin“ der Bundesregierung veröffentlicht. Die Ablehnung der Schriftstellerin Daniela Dahn als Verfassungsrichterin in Brandenburg 1998, nach einer Diffamierungskampagne, war ein weiteres Bubenstück der herrschenden Klasse.
Als im November 2005 die Wahl der Vizepräsidenten des neu gewählten 16. Deutschen Bundestages anstand nominierte die Fraktion der LINKEN Lothar Bisky. Intern war der Vorschlag umstritten, die Frauen favorisierten die Abgeordnete Gesine Lötzsch. Doch Gregor Gysi und Oskar Lafontaine setzten sich durch. Würde der Parteivorsitzende der LINKEN gewählt, wäre das eine Anerkennung der Partei als normale demokratische Partei. Würde er nicht gewählt wäre das ein Skandal und eine Demütigung nicht nur der Partei, sondern aller Ostdeutschen. Ob die Herrschenden das riskieren würden? Das Ergebnis ist bekannt, Bisky fiel viermal durch und verzichtete dann zugunsten von Petra Pau, die gewählt wurde.
Man darf davon ausgehen, dass Lothar Bisky sehr genau um seinen persönlichen Einsatz wusste, auch, dass er durchfallen würde, allerspätestens nach dem zweiten Wahlgang. Ich nehme an, er wusste es von Anfang an. Warum also ließ er das mit sich machen?
Selbstgefällige Zementärsche
Während die Partei den Vorgang umgehend skandalisierte und erklärte, dass mit der Ablehnung der Person Lothar Biskys die Ostdeutschen ein weiteres Mal gedemütigt würden, dürfte Lothar Bisky eine ganz andere Sicht der Dinge gehabt haben. Nein, nicht stellvertretend für die Ossis wurde er abgelehnt, sondern er selbst, die Person Lothar Bisky, war gemeint. Der Plebejer, das Arme-Leute-Kind, Emporkömmling der DDR, wurde dorthin verwiesen, wo er hingehörte, nach unten. Er gehörte nicht dazu. Und weil ihm das von Anfang an klar war, hatte er sich nicht groß gegen das riskante Spiel mit sich und gegen die Kränkung mit Ansage gewehrt, wusste er doch, dass er mit Kränkungen dieser Art, die ihm als Plebejer galten, umzugehen gelernt hatte. Illusionen machte Bisky sich bis zu seinem Ende nicht über die Herrschenden, die er am Ende seines Textes von 1995 klar als „die politische Klasse“, den „Parteienfilz“ und mit Stefan Heym die „selbstgefälligen und selbsternannten Zementärsche“ genannt hatte.
So ist bemerkenswert, dass Lothar Bisky dem Kapitel seines Eintritts in die große politische Arena, er wurde 1993 zum Parteivorsitzenden gewählt, den Titel gab: „Affe im Zoo“. Natürlich, zunächst einmal zielte das auf den Ostdeutschen und auf den „Kommunisten“ Bisky. Das war das Akute, Aktuelle, der kulturellen Fremdheit und Abwertung. Tiefer aber betraf das auch den Plebejer Bisky.
Nebenbei: Plebejer von Herkunft erkennen einander ebenso, wie sie von denen da oben erkannt werden. Lothar Bisky schildert in seiner Autobiographie, wie er darüber mit Gerhard Schröder gesprochen hatte. Dem hat die politische Klasse seine Herkunft auch nie verziehen und, wenn man so will, enthält die kollektive Ächtung seiner Person im Kontext der Freundschaft mit Putin eben diese Botschaft auch: Der taugt am Ende doch nur zum Höfling, zum Diener, zum Knecht.
Auch über die Frage der Demütigungen der Ostdeutschen hatte Bisky schon lange eine eigene, sehr dezidierte Auffassung, die weit über das kurzatmige Kalkül von Gysi und Lafontaine hinaus ging. In einem Manuskript aus dem Januar 1996 legte er eine Skizze zur kultursoziologischen Fassung der längerfristigen Folgen der vereinigungsbedingten Demütigungen breiter Schichten der ostdeutschen Bevölkerung vor. Hellsichtig antizipierte er, wie sich das Narrativ der „Bürger zweiter Klasse“ verfestigen und zu ernsten Folgen für die Demokratie führen würde. Also allgemeinen Grundsatz des Umgangs mit kritischen politischen und gesellschaftlichen Situationen behauptete er seine Ablehnung von „TINA“ („There is no alternative“, Ausspruch der ehem. Britischen Premierministerin M. Thatcher) – es gibt immer Alternativen.
Der "verrückte“ Bisky
Bei der Landtagswahl am 1. September 1999 in Brandenburg verlor die SPD ihre absolute Mehrheit im Landtag und musste sich um einen Koalitionspartner bemühen. Dabei sondierte und verhandelte man ernsthaft auch mit der PDS. Die Verhandlungen scheiterten schließlich und MP Manfred Stolpe koalierte mit der CDU unter Jörg Schönbohm, die Koalition sollte 10 Jahre halten.
Es gibt viele Gründe, warum PDS und SPD nicht zusammenkamen. Letztlich war die Zeit wohl dafür nicht reif. Noch als es dann unter Matthias Platzeck 2009 zu einer rot-roten Regierung kam, war der Widerstand heftig. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich auch die Rolle Lothar Biskys, seine eventuelle Verantwortung für das Scheitern 1999, diskutiert. Darüber soll hier nicht befunden werden, zumal Biskys eigene Darstellung diesbezüglich ganz klar ist.
In der Brandenburger SPD war die Neigung zur CDU stärker als zur PDS, die dezidiert linke Regine Hildebrandt wurde abgeschoben, mit der Verabschiedung von Hans-Otto Bräutigam wurde „der liberale Geist und das intellektuelle Niveau der Landesregierung geschwächt“. (SvT, S.207)
Interessant jedoch ist, dass er während der Verhandlungen eine ihm eigene Fähigkeit im Umgang mit Konflikten demonstrierte: Er konnte auf Knopfdruck „verrückt“ werden. In für ihn schier ausweglosen Situationen, wenn er sich allzu bedrängt und genötigt sah, Dinge zu tun, die ihm innerlich zutiefst widerstrebten, flüchtete er in einen Zustand scheinbarer Unzurechnungsfähigkeit. Man konnte dann mit ihm nicht weiter verhandeln. Lothar Bisky wirkte trunken oder benommen und war es auch. Er schauspielerte das nicht und war sicher nicht durch Alkohol oder Tabletten in diesen Zustand geraten, auch wenn beides dabei von ihm hilfsweise genutzt worden sein könnte. Nein, es war, wenn andere Auswege, in derartigen Konflikten „aus dem Feld zu gehen“ (K. Lewin) ihm verschlossen schienen, eine aus seelischer Not heraus gewählte Metamorphose, eine Realitätsverweigerung. In diesem Fall wage ich zu behaupten, dass er, tief im Innern, die Macht, eine Regierungsbeteiligung nicht wollte.
Häufiger wählte er weitaus schwächere Formen der Verweigerung, etwa wenn er „aus der Rolle“ des Parteivorsitzenden, des Politikers fiel. Andreas Dresen bestand in seiner Abschiedsrede auf der Trauerfeier in der Volksbühne darauf, dass Bisky immer nur den Politiker gespielt habe. In Talkshows oder wenn die Medien nach Personalentscheidungen der Partei fragten, dann demonstrierte er seine Fähigkeit, sich den Erwartungen der Öffentlichkeiten zu verweigern. Die Freiheit war ihm das Wichtigste und er nahm sie sich auf diese Weise immer dann, wenn diese sie ihm nehmen wollten.
Fazit, ein vorläufiges ...
Lothar Bisky, eine kraftvolle Person, ein starker Charakter, geprägt durch seine plebejische Herkunft und Kränkungen, die er auf eine Art und Weise verarbeitete, die ihn stärker, zu einer großen Persönlichkeit machte. Sein Leben lang forschte er für eine Kultur der Anerkennung, kämpfte gegen „denunziatorische Kommunikation“ dort, wo er gerade wirkte. Der kategorische Imperativ von Karl Marx, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« (MEW 1: 385), es war auch der Lothar Biskys, aus diesem Grunde seiner Herkunft geboren.
Quellen:
(ST) Gisela Oechelheuser: Lothar Bisky: „So tief bücke ich mich nicht!“. Dietz Verlag, Berlin 1993
(SvT) Lothar Bisky: So viele Träume. Rowohlt, Berlin 2005
ND, 27./28. Mai 1995, S. 3
Lothar Bisky: Manuskript Medienwissenschaft
Reinhard Haller: Die Macht der Kränkung