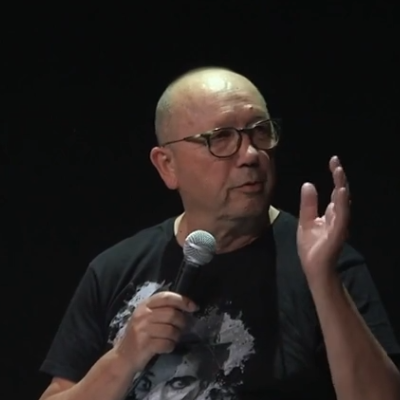Die Organisierende Klassenpartei und die sozial-ökologische Transformation
Die Krise der Beschäftigung in der Autoindustrie, die drohende Deindustrialisierung ganzer Regionen, die Hinwendung betroffener Arbeiter und Arbeiterinnen nach rechts, eine Regierung, die darauf nur mit Aufrüstung antwortet und eine Konversion „falsch herum“ anstößt, all dies macht deutlich: es reicht nicht von links die Beschäftigten in ihren Abwehrkämpfen zu unterstützen. Es braucht Alternativen und eine strategische, sozial-ökologische Industriepolitik von links – die gilt es in den nächsten Monaten zu entwickeln.
Die Industrie in Deutschland gliedert sich grob in Maschinenbau, Elektroindustrie, Autoindustrie, Bahnindustrie, chemische Industrie und Lebensmittelindustrie. Insgesamt arbeiten dort fast sechs Millionen Menschen, 75 Prozent davon Männer. In der Industrie gibt es immer noch eine hohe Tarifbindung und relativ hohe gewerkschaftliche Organisationsgrade. Die Wechselwirkungen zwischen Industriearbeit und Gesellschaft sind literarisch, politisch-ökonomisch und soziologisch gründlich erforscht und vielfach publiziert, von Karl Marx und Friedrich Engels vor fast 180 Jahren[1], in jüngerer Zeit bspw. von Klaus Dörre und Oliver Nachtwey.[2] Durch die sich verändernde Zusammensetzung der Arbeiter*innenklasse, durch tendenziell höhere Bildungsabschlüsse mit entsprechend höher qualifizierten Berufsabschlüssen und mit der Tendenz zur „Dienstleistungsgesellschaft“ nimmt die Bedeutung der Industrie und der klassischen Arbeiter*innen ab – volkswirtschaftlich und gewerkschaftlich-politisch betrachtet hängt jedoch die weitere ökonomische und soziale und damit auch politische Entwicklung weiter zu einem guten Teil an der Industrie – bestenfalls an einer sozial-ökologisch transformierten Industrie, die nachhaltige Produkte umweltschonend herstellt und gesellschaftliche Bedarfe befriedigt.
Als ein Beispiel für die Veränderungen die Belegschaft im Wolfsburger Werk von Volkswagen:
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Jahr |
Belegschaft* |
Arbeiter |
Angestellte |
Verhältnis**
|
|
1985 |
59.500 |
46.000 |
13.500 |
3:1 |
|
2025 |
54.700 |
22.600 |
32.100 |
2:3 |
*Belegschaft ohne Auszubildende, gerundete Zahlen; Quelle: eigenes Archiv, u.a. VW-Geschäftsberichte
** Verhältnis Spalte 2 zu Spalte 3; Arbeiter zu Angestellten
Ein großer Teil der „Angestellten“ sind Techniker*innen und Ingenieur*innen, qualifiziert aus der Produktion heraus oder Kinder von Arbeiter*innen aus dem VW-Werk. Typisch vielleicht die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo, deren Vater als „Gastarbeiter“ aus Italien in das VW-Werk nach Wolfsburg kam. Nach dem Abitur absolvierte Tochter Daniela eine Berufsausbildung bei VW zur Bürokauffrau und später ein berufsbegleitendes Wirtschaftsstudium. Soweit ein Beispiel als Illustration der differenzierteren, vielfältigeren Arbeiter*innnenklasse als vor 40 Jahren.
Um ihrer Rolle als Hoffnungsträgerin gerecht zu werden, muss die durch viele neue Mitglieder und ein tolles Wahlergebnis gestärkte Partei Die Linke Antworten auf neue Herausforderungen geben, oder, wie Harald Wolf sagt: Auf Triggerpunkten tanzen.[3] Ein Triggerpunkt ist offensichtlich der deutschen Männer liebstes Kind, das Auto. Daran hängen auch die Subventionen und der Straßenbau; tieferliegend die Veränderungen in der Industrie, die Deindustrialisierung durch Verlagerungen von Fabriken und der Umbau von Autofabriken und Schienenfahrzeugbetrieben zu Rüstungsschmieden. Umbau und Abbau der Autoindustrie haben längst begonnen. In den zurückliegenden fünf Jahren wurden in der Metall- und Elektroindustrie 130.000 Arbeitsplätze, in der Auto- und Zulieferindustrie 80.000 Arbeitsplätze verlagert oder vernichtet – viermal so viel, wie in der gesamten Kohleindustrie vorhanden waren. Um den Ausstieg aus der Kohle wurde lange gerungen, schließlich ein „Kompromiss“ erzielt: 40 Milliarden Euro für Ausstieg und Umbau im Zeitraum von 2018 bis 2038. Wenn nun die Produktionskapazitäten für den Autobau aus vielerlei Gründen (Marktsättigung, Nachfrageschwäche, Ressourcenbegrenzung, Klimaschutz) gesenkt werden müssen, dann kann und sollte dieser Prozess nicht blockiert werden. Dann muss Die Linke als Partei diesen Prozess mit alternativen Vorschlägen sozial und ökologisch wenden – von überlanger Arbeitszeit und Erschöpfung hin zu radikaler kollektiver Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich zu einem guten Leben für alle; von der überlebten Autoindustrie hin zu einer Industrie für modernen, smarten öffentlichen Verkehr in urbanen Zentren und ländlichen Regionen.
1. Köpfe und Herzen gewinnen, niemanden zurücklassen!
Es gibt viele ernste Gründe, skeptisch in die Zukunft zu schauen: Die Klimakatastrophe nimmt ungebremst ihren Lauf hin zu irreversiblen Kipppunkten, viele sind bereits erreicht; die Kriege kommen dichter an uns ran, die sozialen Garantien der zurückliegenden Jahrzehnte zerbröseln, Nationalisten und Rechtsradikale gewinnen am Stammtisch, auf der Straße, in den Betrieben und an der Wahlurne an Zustimmung. Wenn die Krisen die Menschen zu Zukunftsangst und Verzweiflung treiben, entwickelt sich sozialer und demokratischer Widerstand, es ist aber auch die Stunde der Verschwörungstheoretiker und Demagogen.
Bekannt ist, dass – bei Gleichzeitigkeit von Kollegialität und Solidarität im Betrieb und konservativ-traditionellen Lebensentwürfen und Lebensstilen in der Arbeiterschaft – die Preistreiberei bei Lebensmitteln und Mieten, zu geringe Löhne und soziale Unsicherheit, Kürzungen und Repressionen beim Bürgergeld, verkommene Schulen und löchrige Straßen, Entlassungen und Werksschließungen in der Industrie etc. dazu führen, dass betroffene Menschen einen Statusverlust erfahren und sich zunehmend nach rechts orientieren. Gehofft wird auf „den starken Führer“, geglaubt werden die Geschichten vom faulen Arbeitslosen und von Migranten, die „uns“ die Wohnungen, die Arbeits- und Kindergartenplätze und die Frauen wegnehmen. Umgekehrt ist lange bekannt, dass soziale Sicherheit und Mitbestimmung, Räume für demokratisches Engagement die Immunisierung gegen rechts unterstützen. Sowohl die Ampel-Regierung als auch die aktuelle Regierung von Merz/Klingbeil tragen wissend, durch Tun und Unterlassen, dazu bei, diese gesellschaftlich spaltende Entwicklung zu forcieren.
Besonders schmerzlich in diesem Zusammenhang das Wahlverhalten vieler Arbeiter (v.a. männlich) aus der Industrie. Da die gewerkschaftliche Organisation in der Industrie relativ hoch ist, sind es eben auch viele Gewerkschaftsmitglieder, die rechts wählen. An den Wahlergebnissen in industriellen Zentren ablesbar und in Wahlanalysen nachlesbar: 38 Prozent derjenigen, die sich selbst als Arbeiter bezeichnen, wählten bei der Bundestagswahl die AfD. Entsprechend über dem bundesweiten Schnitt (von 20,8%) die starken AfD-Ergebnisse in Industriestädten, zum Beispiel in Pforzheim, Salzgitter, Zwickau und Wismar. Seitens der AfD ist das verbunden mit massiven Angriffen auf jede Form der industriellen Transformation mit Losungen wie „Rettet den deutschen Diesel“ und Angriffen auf die Gewerkschaften als „korrupte Elite“ und „Sprachrohr der Altparteien“, die die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeitern nicht mehr vertritt: „Eine Gewerkschaft muss patriotisch sein, denn es geht um die Arbeitsplätze in Deutschland.“[4] Das Potential von 38 Prozent AfD-Wähler versucht der rechte Verein „Zentrum“ seit Längerem abzuschöpfen, indem er auch die DGB-Gewerkschaften unterwandert. Bislang war der Verein mit Wurzeln in der Nazi-Szene vor allem in Sachsen und Baden-Württemberg aktiv. Jetzt will der rechte Verein in Nord- und Westdeutschland in der Autoindustrie Fuß fassen und die IG Metall bei den Betriebsratswahlen im kommenden Jahr angreifen – und hat dazu ein „Regionalbüro Zentrum Nord-West“ in Hannover gegründet.
Die Zukunftsängste der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Industrie beruhen in Ost und West, in Brandenburg wie im Ruhrgebiet, auf vielfältigen negativen Erfahrungen. Die Ängste sind berechtigt, denn es gibt die Drohung mit Bürgergeld und Mindestlohn und keine sozialen Garantien, wenn Personalabbau nur noch in tausender Größen oder gar Werksschließungen angekündigt werden, wenn Unternehmen wie ZF, Schaeffler, Conti, Bosch und andere Zulieferer, wenn selbst BMW, Mercedes, Ford und Volkswagen erst die Leiharbeiter*innen und dann die Stammbelegschaft vor die Tür setzen, ganze Werke verlagern und schließen.[5] Es gibt keine staatliche Industriepolitik, keine Anstrengungen der Regierung, diese drohende Deindustrialisierung aufzuhalten, außer durch Hochrüstung. Mit ihren Familienangehörigen macht die Industriearbeiterschaft fast 20 Prozent der Wahlbevölkerung aus. Diese Menschen sollten nicht der AfD überlassen werden. Sie sind auch für Die Linke eine nicht zu vernachlässigende Größe.
2. Warum Industriearbeiter verzweifeln:
Wasser auf die Mühlen der AfD
Im kleinen Städtchen Sebnitz in der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien lässt Bosch Werkzeuge (Power Tools) produzieren und ist der größte Arbeitgeber, allerdings seit Jahren schrumpfend. Die verbliebenen 280 Arbeitsplätze will der Konzern jetzt kündigen und den Betrieb nach Osteuropa verlagern. Die Folgen eines Rückzugs von Bosch aus der Region Ostsachsen sind fatal. „Es gibt keine adäquaten Arbeitsplätze weit und breit, keine Perspektiven für unsere Kolleginnen und Kollegen und keine Ausbildungsmöglichkeiten für industrielle Produktion in der Region“, beschreibt Betriebsrat Jens Ehrlichmann die Situation. Von einer Kundgebung am 14.6.2025 berichtet die IG Metall: „Auch Vertrauensleute aus anderen Bosch-Standorten – Hildesheim, Dresden, Eisenach oder Leinfelden – sind mit Delegationen in Sebnitz vor Ort. Sie alle fürchten, dass Sebnitz nur der Anfang ist und es über kurz oder lang auch den anderen Standorten an den Kragen geht, weil es Bosch nur Gewinnmaximierung im Kopf hat.“[6] Die AfD erhielt in Sebnitz bei der Bundestagswahl 54 Prozent der Zweitstimmen. Die Menschen sind nicht nur von der Arbeit erschöpft und von Angst geplagt, sondern verzweifeln an der Unerbittlichkeit der Konzerne und an der teilnahmslosen Zuschauerrolle, die die Regierungen auf Landes- und Bundesebene einnehmen. In dieser Situation kann und muss die Linke als Pol der Hoffnung Alternativen zur herrschenden Politik aufzeigen, eine emanzipatorische, antimilitaristische Klassenpolitik in „Transformationsräten“ (Riexinger) oder „transformativen Zellen“ (Brand/Wissen) entwickeln, gemeinsam mit allen davon Betroffenen, und diese beispielhaft populär dort vertreten, wo die Konflikte sich zuspitzen.[7]
Umbau statt Abbau
Auch im schwäbischen Leinfelden, in Bühl in NRW und im niedersächsischen Hildesheim will Bosch Werke mit tausenden Arbeiterinnen und Arbeitern schließen. Dagegen regt sich Widerstand bis in die Kommunalpolitik. Der Hildesheimer Stadtrat hat eine Resolution gegen die befürchtete Schließung verabschiedet. Der Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Stadtrat, Ralf Jürgens, erklärt in der Stadtratssitzung: „Am 20.5.2025 haben die Verantwortlichen im Bosch-Konzern die Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der IG Metall abgebrochen. Wir haben hier im Rat vor fast zwei Monaten eine Resolution beschlossen, alles dafür zu unternehmen, den Standort zu stärken und langfristig zu sichern. Was passiert zur Umsetzung dieser Resolution? Wir als Linke sehen nicht nur den Hildesheimer Standort. Zusammenhalt zählt! Hier werden Elektromotoren für die Autoindustrie gebaut, wichtig zum Stopp der Erderwärmung weg vom Verbrenner. Die Bilanz von Bosch weist im Jahr 2024 einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro aus, es werden 186 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet und es gibt eine Gewinnrücklage von 41 Milliarden Euro. Daraus leitet sich die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung statt Entlassungen und nach Umbau statt Abbau ab – hin zu sicheren Arbeitsplätzen und nachhaltiger Produktion.“ Die Linke schlägt vor, die nächste Stadtratssitzung im Bosch-Werk durchzuführen und einen gesellschaftlichen Dialog zu organisieren.
Verschärfung der Konkurrenz durch Personalabbau und Arbeitszeitverlängerung?
Die Konkurrenz in der Autoindustrie wird dramatisch verschärft durch den Auftritt neuer Player wie Tesla oder chinesischer Hersteller wie BYD. Der Abbau von Kapazitäten und Arbeitsplätzen in der traditionellen Autoindustrie kann nicht sinnvoll kompensiert werden durch neue Autofabriken aus USA, China oder Südkorea, da die Überkapazitäten des einen Konzerns durch neue Kapazitäten des anderen Konzerns ersetzt werden. Hierzu ist auch eine kritisch-solidarische Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft erforderlich, der es in erster Linie um Arbeitsplätze an sich und die Qualität der Arbeit geht, die aber unter den Konkurrenzbedingungen nicht verbessert werden wird. Im Doppelinterview mit dem Arbeitgeberpräsidenten von Gesamtmetall sagt die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner unter anderem: „Unser eigentliches Problem ist, dass sich deutsche Unternehmen bei der Elektromobilität und der Digitalisierung im Fahrzeug die Butter vom Brot nehmen lassen.“[8]
Für Die Linke rückt gleichermaßen das „Was“ der Produktion in den Mittelpunkt. Die Linke will gute Arbeit an sinnvollen, nachhaltigen und bedarfsgerechten Produkten und eine Minimierung der die Arbeitsbedingungen verschlechternden Konkurrenzverhältnisse. Cem Ince, der linke Bundestagsabgeordnete aus Salzgitter, sagt dazu: „Wenn der Autoabsatz zurückgeht, können auch, wie in Osnabrück für MOIA, smarte Busse für den öffentlichen Verkehr gebaut werden. Dafür müssen Länder und Kommunen Geld bekommen: Busse und Bahnen statt Panzer und Raketen.“[9]
Der Volkswagen-Konzern hat den Abbau von 40.000 Arbeitsplätzen, die Schließung der Fabriken in Dresden und Osnabrück angekündigt und für die Werke in Hannover, Zwickau und Emden keine Auslastung vorgesehen. Die Fertigung des legendären Bulli wurde aus Hannover in die Türkei verlagert, die des Golf geht von Wolfsburg nach Mexiko. Gleichzeitig werden den Arbeiterinnen und Arbeitern im Wolfsburger Werk Überstunden und Wochenendarbeit aufgezwungen, in Sachsen wird ernsthaft über eine „Sonderwirtschaftszone“[10] mit Potenzial für die Rüstungsindustrie gesprochen: „Hintergrund ist der Produktionsabbau beim Autobauer Volkswagen “.[11] Mehr noch, durch den erpresserischen Tarifvertrag aus dem Dezember 2024, müssen tausende Arbeiterinnen und Arbeiter, für die bisher die 33-Stunden-Woche galt, ohne Lohnausgleich ab 1.7. diesen Jahres zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten. Angleichung des Tarifvertrages hin zur Verlängerung statt Verkürzung der Arbeitszeit. Das lässt sich in drei Währungen ausdrücken:
- Mehr als 2.000 Euro, die jeder einzelnen Person pro Jahr weggenommen werden und die, summiert, mehr als 100 Millionen Euro höheren Gewinn für die Aktionäre bedeuten.
- Der Stress und die Erschöpfung der Arbeiterinnen und Arbeiter nehmen zu, die Erholungszeiten werden um zwei Stunden pro Woche oder 90 Stunden im Jahr reduziert – mit allen negativen gesundheitlichen und familiären Folgen.
- Der Gewerkschaft und dem Betriebsrat wurde eine empfindliche Niederlage beigebracht, die dem Credo von Wolfgang Porsche folgt, „er habe nichts gegen Mitbestimmung, aber ...“ und das Ansehen und die Autorität der Interessenvertretung unter den Arbeiterinnen und Arbeitern deutlich schwächt.[12]
3. Abwehrkämpfe und Umbau statt Abbau
Wenn es Volkswagen unter tariflichen Bedingungen und bei viel gelobter Mitbestimmung gelingt, die Arbeitszeit für tausende Arbeiterinnen und Arbeiter zu verlängern, ist die logische Konsequenz im Kapitalismus, dass andere Unternehmen das Gleiche tun müssen – so geschehen zum Beispiel beim Zughersteller Stadler in Berlin. Ja, es geht um Abwehrkämpfe. Wenn diese Abwehrkämpfe aber verloren werden, wirkt sich das auf alle Arbeitsverhältnisse, auf die Arbeitsbeziehungen und das Sozialgefüge in allen Branchen negativ aus. Durch politische und parlamentarische Initiativen für den Erhalt des 8-Stunden-Tages, für eine gesetzliche 40-Stunden-Woche können Gewerkschaften und Die Linke in die Offensive kommen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer großen Mehrheit wollen raus aus der Erschöpfung, raus aus der Tretmühle und weg von überlangen Arbeitszeiten. Die IG Metall scheint nicht gut beraten zu sein, auf die Forderung nach der Vier-Tage-Woche, also nach kollektiver Arbeitszeitverkürzung, zu verzichten.
Die Krise der Industrie ist unübersehbar. Nachdem Rheinmetall sich die VW-Fabrik in Osnabrück angesehen hat, verweist der CDU-Wahlkreisabgeordnete aus Wolfsburg in orwellscher Manier auf die wachsende Rüstungsindustrie: „Wir haben ja gute Voraussetzungen: Autobahn, Mittellandkanal, Kraftwerke und Personal. Es geht ja nicht um Krieg. Kriegsfähigkeit erhält den Frieden.“[13] Im Zweifel, also vor die Wahl Job oder Erwerbslosigkeit gestellt, werden die Beschäftigten die Jobs in der Kriegswirtschaft wählen. Auch, wenn es das unproduktivste ist, was gebaut werden kann, auch wenn es der persönlichen und gesellschaftlichen Erschöpfung Vorschub leistet. Aber es genügt nicht, mit dem Finger auf die Planlosigkeit der Manager oder auf die Strategielosigkeit der Regierung zu zeigen, die das mehr oder weniger bewusst genau so machen, wie es gegenwärtig läuft.
Es bedarf eines gewerkschaftlichen und politischen Kampfes um viel mehr Mitbestimmung und Demokratie bei solchen, das ganze Land betreffenden Fragen. Es bedarf der aktiven Solidarität aller Menschen in den Regionen, die von der Deindustrialisierung betroffen sind. Es bedarf vor allem betriebsübergreifender Aktionen bis hin zum Streik ganzer Konzernbelegschaften, ganzer Branchen und ganzer Regionen, um den Kahlschlag oder die Konversion falsch herum[14] zur Kriegswirtschaft zu verhindern. Dazu braucht es konkrete Alternativen für jeden einzelnen Betrieb. Wie kann Konzernen wie Bosch untersagt werden, die Produktion schlicht zu verlagern? Was kann stattdessen nachhaltig produziert werden? Wer sind die Abnehmerinnen und Abnehmer für das, was statt bisheriger Produkte für den gesellschaftlichen Bedarf gebaut werden wird? Wie geht das technisch und betriebswirtschaftlich? Welche Rolle spielen die Kommunen, die Länder, der Staat insgesamt dabei?
Auf diese Fragen müssen jetzt Antworten erarbeitet werden. Eine strategische, sozial-ökologische Industriepolitik von links, seitens der Wissenschaft, der Partei und der Gewerkschaften, ist gefragt. Natürlich gehört eine kollektive Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich dazu, die Vier-Tage-Woche für alle. Die Auto- und Zulieferindustrie wird weiter und schneller Personal und Kapazitäten abbauen. An zwei bis drei Brennpunkten wie in Zwickau, in Osnabrück und im Raum Stuttgart könnten mit geeinten Kräften der erstarkten Landes- und Kreisverbände der Partei sichtbare Erfolge der „organisierenden Klassenpartei“ erkämpft werden. Um am Beispiel Bosch zu bleiben und die Erwartungen von Arbeiterinnen und Arbeitern, von IG Metall und Betriebsrat deutlich zu machen: "Die Ankündigung des Unternehmens, Personal in diesem Ausmaß zu reduzieren, ist für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht", kritisierte Frank Sell, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Autozuliefersparte von Bosch. Der Widerstand gegen die Pläne werde nun "auf allen Ebenen" organisiert.[15]
Die Kriegswirtschaft kann und soll diese Lücken nicht schließen. Der Bedarf an industriell gefertigten Produkten für den öffentlichen Verkehr ist groß, ist aber nicht so gewinnträchtig wie die Autoindustrie. Wenn es nicht gelingt, dafür konkrete Alternativen zu entwickeln, werden Stuttgart und Wolfsburg das Schicksal von Detroit und dem Rust Belt erleiden, viele Kommunen werden verarmen und die Rechten werden weiter gewinnen.
Die Industrie ist nicht alles und andere volkswirtschaftliche Bereiche haben an Bedeutung gewonnen. Ganzheitlich gedacht sind jedoch ohne einen Fokus auf die Industriearbeiter*innen und die sozial-ökologische Transformation die aktuellen ökologischen, sozialen und politischen Krisen nicht zu lösen. Es geht dabei zentral um zukunftsfähige Mobilität und um die dazu erforderliche Industrie- und Wirtschaftspolitik zum Beispiel für „grünen Stahl“ und für gute Arbeit. Im Fokus kann dabei nicht die gesamte Industrie sein. Eine Konzentration auf Schwerpunkte, auf die Cluster im Raum Stuttgart, in Niedersachsen, in Zwickau und Eisenhüttenstadt könnte ausstrahlen und sichtbar machen, dass Widerstand gegen Verlagerung und Deindustrialisierung möglich und nachhaltige Alternativen durchsetzbar sind. Dabei können, wie schon im Bündnis für eine sozialverträgliche Mobilitätswende,[16] alle gesellschaftlichen Gruppen und Akteure erreicht und aktiv einbezogen werden, die an der Eindämmung der Klimakatastrophe, an Abrüstung, an Verkehrspolitik und an der sozial-ökologischen Transformation interessiert sind bzw. schon arbeiten: Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbände, Friedensbewegung, Naturschutzverbände und Verkehrswendebewegung.
[1] Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei; 1848
[2] Klaus Dörre, „In der Warteschlange“; Oliver Nachtwey, „Abstiegsgesellschaft“, mit dem symbolträchtigen Dauerlauf auf der Rolltreppe nach unten.
[3] https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/auf-triggerpunkten-tanzen/[1]
[4] Pressekonferenz zur Eröffnung des Zentrum-Büros am 14.4.2025 in Hannover
[5] Angekündigter Personalabbau bei ZF (14.000), Schaeffler (2.800), Conti (2.200), Bosch (6.000), Volkswagen-Konzern (40.000), BMW (6.000), Mercedes (15.000), Ford (4.000).
[6] https://igm-zwickau.de/aktuelles/meldung/kundgebung-mit-grosser-solidaritaet-fuer-die-beschaeftigten-von-bosch-sebnitz[2]
[7] Siehe Kerstin Wolter: https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/linke-polarisierung/[3]
[8] https://www.haz.de/wirtschaft/metall-und-elektroindustrie-in-der-krise-ig-metall-und-gesamtmetall-suchen-loesungen-ASUIDERTWNGZ7CND5P6DKQBRWM.html[4]
[9] Cem Ince, Instagram, 20.3.2025
[10] https://www.dgb-bildungswerk.de/sites/default/files/media/product/files/Arbeitspapier_Sonderwirtschaftszonen.pdf[5]
[11] https://www.radiochemnitz.de/beitrag/taskforce-fordert-sonderwirtschaftszone-fuer-suedwestsachsen-872987/[6]
[12] https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-wolfgang-porsche-legt-sich-mit-vw-betriebsrat-an-a-1256367.html[7]
[13] https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/vw-krise-alexander-jordan-will-ueber-ruestungsindustrie-nachdenken-R5QU3Z72WJDU7MG3MRRPM4RBCM.html[8]
[14] Mario Candeias, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Juni, https://www.rosalux.de/news/id/53454/konversion-falschherum[9]
[15] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/bosch-stellenabbau-104.html[10]
[16] https://bayern.igmetall.de/aktuell/breites-buendnis-fordert-mobilitaetswende-fuer-deutschland[11]
Links:
- https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/auf-triggerpunkten-tanzen/
- https://igm-zwickau.de/aktuelles/meldung/kundgebung-mit-grosser-solidaritaet-fuer-die-beschaeftigten-von-bosch-sebnitz
- https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/linke-polarisierung/
- https://www.haz.de/wirtschaft/metall-und-elektroindustrie-in-der-krise-ig-metall-und-gesamtmetall-suchen-loesungen-ASUIDERTWNGZ7CND5P6DKQBRWM.html
- https://www.dgb-bildungswerk.de/sites/default/files/media/product/files/Arbeitspapier_Sonderwirtschaftszonen.pdf
- https://www.radiochemnitz.de/beitrag/taskforce-fordert-sonderwirtschaftszone-fuer-suedwestsachsen-872987/
- https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-wolfgang-porsche-legt-sich-mit-vw-betriebsrat-an-a-1256367.html
- https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/vw-krise-alexander-jordan-will-ueber-ruestungsindustrie-nachdenken-R5QU3Z72WJDU7MG3MRRPM4RBCM.html
- https://www.rosalux.de/news/id/53454/konversion-falschherum
- https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/bosch-stellenabbau-104.html
- https://bayern.igmetall.de/aktuell/breites-buendnis-fordert-mobilitaetswende-fuer-deutschland