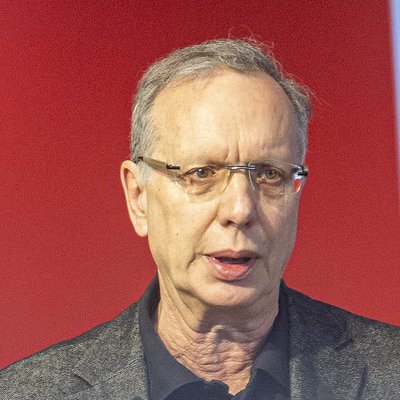Wir brauchen einen neuen linken Grundkonsens
Acht Vorschläge zur inhaltlichen Verständigung in der LINKEN
Die LINKE befindet sich in einer tiefen Krise – nicht ihrer ersten, aber doch einer ihrer schwersten. Innerparteiliche Konflikte wurden in der Vergangenheit nicht gelöst, auf Konfliktlinien, die sich seit 2008 neu herausgebildet haben, nur ungenügend reagiert. Das Ergebnis ist ein disparates Erscheinungsbild der Partei, die Wahrnehmung der LINKEN in der Bevölkerung oftmals durch sich widersprechende prominente Vertreter*innen bestimmt.
Vor diesem Hintergrund fordern einige in unserer Partei eine Programmdiskussion, um uns neu über unsere Grundlagen zu verständigen. Unbestritten – wir brauchen einen neuen linken Grundkonsens. Aber wir sind der Ansicht, dass eine allgemeine Programmdebatte ein denkbar schlechtes Instrument ist, um die Krise zu überwinden. Die Diskussion über ein neues Grundsatzprogramm würde die Kräfte für einen langen Zeitraum nach innen richten und weniger in eine zielgerichtete Intervention in gesellschaftliche Konflikte.
Statt uns in zahllosen Detailfragen aneinander abzuarbeiten, sind wir der Auffassung, dass es darauf ankommt, jene wenigen, aber zentralen Fragen zu klären, in denen es tatsächlich einen politischen Dissens gibt. Unserer Ansicht nach sind dies vor allem folgende Punkte:
1/ Linke Außenpolitik: für einen anderen Internationalismus. Am sichtbarsten sind unsere Defizite in der Außenpolitik. Dabei geht der Vorwurf, in der LINKEN sammelten sich „Putin-Versteher“, an der Sache vorbei. Die Wahrheit ist, dass unsere Partei das „System Putin“ eben nicht verstanden hat. Gegenüber den postsowjetischen Ländern und China hat die LINKE auf jene politisch-ökonomische Gesellschaftsanalyse verzichtet, die bei uns ansonsten unwidersprochen als Voraussetzung jeder Politik gilt. Genau dieses Fehlen einer Analyse hat zu einer dramatischen Fehleinschätzung der internationalen Lage geführt.
Was bedeutet das nun für eine außenpolitische Neubestimmung? Wir sind nicht der Ansicht, dass die LINKE ihre ablehnende Haltung zur NATO oder ihre antimilitaristische Grundhaltung aufgeben sollte. Was wir stattdessen radikal infrage stellen müssen, ist unser Internationalismus-Begriff. Teile der Partei ordnen die Welt entlang einer „Staaten-Solidarität“. Dieses Lagerdenken war schon zu Zeiten des Blockkonflikts fragwürdig und ist heute, in Zeiten konkurrierender kapitalistischer Mächte, ganz einfach nur noch falsch. Um die internationale Situation wieder besser zu verstehen, müssen wir die innergesellschaftlichen Widersprüche und Herrschaftsverhältnisse in den Blick nehmen. Im geopolitischen Wettstreit zwischen den kapitalistischen Supermächten USA und China haben Linke nichts zu gewinnen; unser Platz ist an der Seite all jener politischen Bewegungen und Parteien, die für Solidarität, Gleichheit und demokratische Grundrechte in ihren Ländern kämpfen. Unsere Solidarität und Loyalität gilt nicht Staaten, sondern streikenden chinesischen Wanderarbeiterinnen und den unabhängigen Gewerkschaften in Hongkong, der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA, den antiautoritären Menschenrechtsgruppen und Kriegsgegner*innen in Russland…
2/ Das System Putin ernst nehmen. Für die aktuelle Debatte bedeutet das, sich von jenen Erklärungsmustern zu verabschieden, die den russischen Militarismus in erster Linie aus der Politik von USA und NATO ableiten und damit indirekt legitimieren. Wir sollten ernst nehmen, was uns antiautoritäre Linke aus postsowjetischen Gesellschaften schon lange sagen: Nach dem Ende der UdSSR hat sich in Russland ein kleptokratisches Regime etabliert, das einen aggressiven Nationalismus und offene Gewaltausübung nach innen und außen miteinander verbindet. Nach 1991 machten sich Vertreter der alten sowjetischen Elite, sprich: Partei- und Staatsfunktionäre sowie Geheimdienstoffiziere, den Staat zur Beute, und aufstrebende Oligarchen kaperten sich die privatisierten Betriebe. Eine spezifische Verflechtung von Politik und Wirtschaft entstand: Der Staatsführung gegenüber loyale Oligarchen können sich ihre Pfründe sichern; denjenigen, die Loyalität vermissen lassen, droht der Verlust von Geld und Freiheit. Korruption und Machtmissbrauch gehören dabei zum Alltag.
Russland hat seit dem Ende der Sowjetunion eine Reihe von Kriegen geführt bzw. in bürgerkriegsähnliche Konflikte in den postsowjetischen Republiken interveniert. Der Tschetschenienkrieg, Georgien, die Annexion der Krim und die militärische Unterstützung der Separatistengebiete in der Ukraine, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der Transnistrienkonflikt in Moldau, die Niederschlagung des Aufstands in Kasachstan und aktuell der Angriffskrieg auf die Ukraine stehen für eine Kette militärischer Interventionen. Sie alle dienten der Stützung autoritärer Regime bzw. nutzten Nationalitätenkonflikte aus, um Spannungsherde in den ehemaligen Sowjetrepubliken zu erzeugen und so Einfluss auf deren Politik zu nehmen oder die Länder zu destabilisieren. Dabei geht es dem Kreml darum, seine Einflusssphäre zu sichern und die Etablierung missliebiger politischer und wirtschaftlicher Systeme zu verhindern. Auch die Unterstützung des Despoten Lukaschenko bei der brutalen Niederschlagung des Aufstands in Belarus diente diesem Ziel. Die Intervention in den Syrien-Krieg war eine geopolitische Verlängerung dieser Strategie.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine muss in diesem Sinne auch aus den inneren Bedürfnissen des Systems heraus erklärt werden. Zwar ist die Ukraine keine „oligarchenfreie-Zone“, aber der dort existierende Grad bürgerlicher Freiheiten unterscheidet sie gravierend vom autoritären Regime Putins, das in den letzten Jahren die Repression noch massiv verschärft hat. Eine funktionierende parlamentarische Demokratie mit den damit verbundenen Freiheitsrechten stellt für das System Putin eine große Gefahr – ebenso wie es die Demokratiebewegung in Belarus war. Es spricht Vieles dafür, dass der russische Angriffskrieg weniger mit der NATO-Expansion als mit der inneren Entwicklung der ukrainischen Gesellschaft zu tun hatte.
Diese Analyse muss Ausgangspunkt unserer Politik sein. Wir dürfen daraus aber nicht – wie ein Großteil der Öffentlichkeit – den Schluss ziehen, dass sich der Autoritarismus in Russland mit militärischen Mitteln besiegen oder auch nur einhegen ließe. Auf die autoritären Tendenzen im krisenhaften Kapitalismus gibt es keine simplen Antworten! Die Konfrontation von Nationalstaaten ist kein Instrument zur Demokratisierung. Unsere Verbündeten sind die antiautoritären Bewegungen in den postsowjetischen Gesellschaften selbst – und eben nicht die ebenfalls hochgerüsteten Militärapparate des Westens.
3/ Kein Materialismus ohne Ökologie. Das zweite große Defizit der LINKEN besteht darin, dass wir als Partei den Zusammenhang zwischen sozialer und ökologischer Krise nicht ausreichend verstehen. Häufig wird von zwei voneinander unabhängigen Feldern ausgegangen: auf der einen Seite die „materiellen Interessen von Beschäftigten“, auf der anderen Seite „die Natur“. Doch in Wirklichkeit sind Klassenfrage und ökologische Krise gerade im globalisierten Kapitalismus untrennbar miteinander verschränkt. Die kapitalistische Wirtschaftsweise beruht auf dem Raubbau an Mensch und Natur. Sprich: Konkurrenz, Wachstum und Profitstreben zerstören das ökologische Gleichgewicht und bedrohen die „materiellen Interessen“ der Beschäftigten.
100 Unternehmen sind weltweit für 70 Prozent des Co2-Ausstosses verantwortlich, die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung verursachen mehr als die Hälfte der Emissionen. Umgekehrthaben Extremwetterereignisse (Stürme, Trockenheit, Hitzeperioden und Überschwemmungen) vor allem für die ärmeren und vulnerablen Bevölkerungsgruppen fatale Konsequenzen. Sie sind es, die sich nicht mehr ernähren können, wenn die Lebensmittelpreise aufgrund schlechter Ernten steigen.
Die materiellen Folgen von Klimawandel und Artensterben werden auch in reichen Industriestaaten wie Deutschland zu spüren sein. Deshalb verteidigen wir nicht abstrakt „die Natur“, sondern vor allem die Lebensperspektiven der einfachen Menschen, wenn wir, wie der Soziologe Klaus Dörre einfordert, für „eine Nachhaltigkeitsrevolution“ eintreten,. Statt die ökologische Transformation zu bremsen, muss die LINKE diese mutig vorantreiben und sozial gestalten, sprich dafür sorgen, dass Konzerne und Reiche (und eben nicht die einzelne Konsument*in) die Transformationskosten tragen.
Angesichts der drohenden Klimakatastrophe hat der Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft u.a. mit dem Übergang zur Elektromobilität und dem Ende der Nutzung von Kohle längst begonnen. Diese Transformation bleibt aber in der kapitalistischen Logik von Standortwettbewerb, Maximierung von Warenabsatz und Profit. Wenn es dabei zum Abbau von Arbeitsplätzen, Standortverlagerungen, Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen kommt, so liegt dies nicht am Übergang zu einer ökologischeren Produktion, sondern am fortbestehenden kapitalistischen Verwertungsinteresse! Es ist, wie die Belegschaft des von der Schließung bedrohten Werks von Bosch in München Berg am Laim formuliert hat: „Wir wehren uns gegen diesen Versuch, unser Werk unter dem Deckmantel des Klimaschutzes zu schließen, und fordern den Erhalt unseres Standortes und die Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion. Der Versuch, unser Werk nach Nürnberg, Tschechien oder Brasilien zu verlagern, hat nur einen Grund: Man verspricht sich davon größere Profite. Dieser Wunsch und nicht der Klimaschutz steht hinter der Schließung.“ Und: „Es gibt dutzende Industriegüter, die wir angesichts der steigenden Temperaturen dringend brauchen: Wärmepumpen, Busse und Bahnen für den öffentlichen Verkehr, Geräte zur Anpassung an den Klimawandel. Was wir nicht brauchen ist eine Produktion für den Profit.“
4/ Für einen Umbau der Produktions- und Lebensweise. Schon Ende der 1960er Jahre warfen Linke der Sozialdemokratie vor, den Sozialismus auf ein plattes Verteilungsprojekt reduziert zu haben. Dieser Einwand ist heute richtiger denn je.
Der Kapitalismus steuert unserer Überzeugung nach auf eine ökologische und soziale Großkrise zu, in der sich Klimawandel, die Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten, die Ressourcenverknappung und Kriege auf unheilvolle Weise gegenseitig befeuern. Vor diesem Hintergrund reicht es nicht mehr, für eine gerechtere Verteilung des Nationaleinkommens einzutreten, während man gleichzeitig dazu beiträgt, „die Wirtschaft am Laufen zu halten“. Die LINKE hat nur eine Zukunft, wenn sie das Bestehende infrage stellt und den sozialen und ökologischen Systemwechsel als ihr Projekt begreift.
Wenn der ökologische, sprich materielle Kollaps ganzer Gesellschaften verhindert werden soll, muss die kapitalistische Produktions- und Lebensweise radikal umgebaut werden. Dafür benötigen wir eine transformatorische Industriepolitik. Das bedeutet: Die unterschiedlichen und sich teilweise noch widersprechenden Anliegen aus Gewerkschaften und Umweltbewegungen müssen aktiv zu einem Projekt des „Guten Lebens für Alle“ zusammengeführt werden. Dieses müsste sich unserer Meinung nach auf fünf Säulen stützen: 1) Eine drastische Reduktion des Stoffwechsels unserer Gesellschaft mit der Natur („Nachhaltigkeitsrevolution“), 2) eine deutliche Verkürzung der Arbeitszeit, 3) eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, 4) die Durchsetzung anderer Formen des Konsums und des Zusammenlebens (mehr öffentliche Infrastrukturen, weniger Ressourcen fressender Individualkonsum), 5) die Demokratisierung der Wirtschaft.
Die LINKE muss hier mehr wagen: Die kapitalistische Krise setzt die Planung als wirtschaftspolitisches Instrument neu auf die Tagesordnung. Beim Umbau der Stromproduktion und der Versorgung Deutschlands mit Gas und Öl erleben wir, dass auch unsere politischen Kontrahenten in schwierigen Momenten keineswegs auf „Marktkräfte“, sondern auf Planung und politische Intervention setzen. Bei der anstehenden (und alternativlosen) Transformation von Industrie und Infrastrukturen werden wir dies noch häufiger erleben. Unsere Aufgabe als LINKE muss es sein, eine Planung ins Gespräch zu bringen, die sich nicht an Profitinteressen, sondern an gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert. Ein Ansatzpunkt hierfür könnten Transformationsräte aus Gewerkschaften, Konsument*innen, Umweltverbänden, Betrieben und Politik sein, die den ökonomischen Prozess demokratisieren.
5/ Gemeinwohl statt Profite. Gemeineigentum stärken. In der deutschen Bevölkerung dürfte es eine deutliche Zustimmung für die Aussage geben, dass eine konsequente Klimapolitik sinnvoll und mehr soziale Gleichheit wünschenswert wären. Dass dennoch nicht entsprechend gehandelt wird, liegt an den Eigentumsinteressen, sprich an den Gewinnvorstellungen der Konzerne und Kapitalfonds. Die LINKE ist die einzige Partei, die diesen Zusammenhang erkennt: Wer eine ökologische Politik machen will, muss sich mit den bestehenden Eigentumsverhältnissen anlegen.
Wir müssen uns deshalb als politische Kraft profilieren, die dem „demokratischen Gemeineigentum“ zentrale Bedeutung beimisst. Der Vorsitzende der Schweizer Sozialdemokratie Cédric Wermuth und der langjährige Gewerkschaftssekretär Beat Ringger haben diesen Ansatz in einem lesenswerten Buch als „Service-Public-Revolution“ bezeichnet, also als einen politischen Prozess, bei dem das (relativ) gemeinwohlorientierte und (relativ) demokratische Prinzip öffentlicher Dienstleistungen (bei Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Medien etc.) vertieft und auf andere Bereiche, also auch auf Industriebetriebe, ausgeweitet wird. Wir als LINKE haben unter dem Schlagwort „Infrastruktursozialismus“ etwas Ähnliches propagiert. Damit ist nicht gemeint, dass die kommunale Trägerschaft eines Krankenhauses schon die Lösung aller Probleme wäre – wir alle wissen, dass auch öffentliche Einrichtungen vom Neoliberalismus durchdrungen worden sind. Es geht vielmehr um einen Dreiklang, der überall Grundlage unserer Politik sein sollte: Gemeinwohl stärken // Gemeineigentum ausbauen // Öffentliche Einrichtungen und Institutionen demokratisieren.
6/ „Revolutionäre Realpolitik“: Unsere Partei hat sich in der Vergangenheit häufig an zwei gleichermaßen unproduktiven Positionen abgearbeitet. Auf der einen Seite haben sich manche von uns an eine kämpferische, aber für konkrete gesellschaftliche Auseinandersetzungen oft folgenlose Revolutionsrhetorik geklammert, bei der man den radikalen Bruch propagiert, aber kaum Wege aufzeigt, wie die gewünschten Veränderungen auch durchgesetzt werden können. Auf der anderen Seite kam und kommt es immer wieder vor, dass Parteigliederungen und Funktionsträger*innen in Gemeinden und Landesregierungen ihren transformatorischen Anspruch im Alltagsgeschäft aus den Augen verloren, die bestehenden Zustände nur verwaltet und bisweilen sogar neoliberale Politik mitgetragen haben.
Es ist an der Zeit, dass wir an diesem Punkt dazulernen und einen Schritt weitergehen. Wir brauchen auf der einen Seite eine bewegungsorientierte Politik, die gesellschaftlichen Protest mobilisiert, sich dabei aber auch immer die Frage stellt, wie dieser Protest in Erfolge umgemünzt werden kann. Die Kampagne Deutsche Wohnen & Co Enteignen, aber auch die Streikbewegung an den Krankenhäusern sind Beispiele dafür, wie das gehen kann. Auf der anderen Seite benötigen wir eine institutionelle Politik, die ihren Erfolg nicht daran misst, ob die LINKE Minister*innen stellt, sondern ob wir soziale und demokratische Reformen durchsetzen, die es ohne uns nicht gegeben hätte. Dass die Berliner LINKE, obwohl in der Regierung, den Volksentscheid für die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen gegen den Widerstand der Koalitionsparteien SPD und Grüne aktiv unterstützt hat, zeigt, dass man auch in Regierungen als Partei eigenständig und über das jeweilige Regierungshandeln hinausweisend handeln kann. In diesem Sinne wird die Regierungsbeteiligung der LINKEN in Berlin daran gemessen werden, ob es der Partei gelingt, dem Votum der Stadtgesellschaft auch in der Landesregierung Geltung zu verschaffen. Als Gesamtpartei müssen wir begreifen, dass weder die Regierungsbeteiligung schon für politische Macht sorgt, noch die Oppositionsrolle eine Garantie dafür ist, dass die Partei eine positive Rolle in gesellschaftlichen Kämpfen spielt. Statt weiter abstrakt über Regierung vs. Opposition zu streiten, sollten wir entlang von zentralen Kriterien debattieren: Welche Haltung der LINKEN trägt am ehesten zur gesellschaftlichen Mobilisierung bei? Auf welche Weise entfalten wir am ehesten den institutionellen Druck, um Veränderungen durchzusetzen?
7 / Schluss mit der Milieu-Debatte. Kaum etwas hat uns in vergangenen Jahren so geschadet, wie die Milieudiskussion, die uns –meistens von bürgerlichen Feuilletons und Talkshows – aufgezwungen wurde. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung stand die Kritik des „progressiven Neoliberalismus“, die sich ursprünglich gegen das Establishment der Demokratischen Partei in den USA richtete, in Deutschland am ehesten auf die Grünen und Teile des akademischen Betriebs zutraf, mit der Praxis der LINKEN aber eigentlich wenig zu tun hatte. Die zentrale These in diesem Zusammenhang lautete, die Linke habe sich zu viel mit Minderheitenthemen und Kulturkämpfen beschäftigt und deshalb den Kontakt zu ihrer alten Anhängerschaft verloren.
Diese Debatte geht unserer Meinung nach am eigentlichen Problem vorbei. Dass die LINKE unterschiedliche Milieus zusammenführen soll, war 2007 Gründungsgedanke der Partei. Anders kann es auch gar nicht sein – nur wenn die LINKE gewerkschaftliche, feministische, ökologische, antimilitaristische und antirassistische Positionen aktiv verbindet, also wenn sie Hartz-4-Empfängerinnen, Paketboten, kritische Akademiker, Industriearbeiter, Krankenhausbeschäftigte, solidarisch gesonnene Menschen und diskriminierte Gruppen gleichermaßen anspricht, wird sie Bestand haben. Anstatt Milieus gegeneinander auszuspielen, ist es unsere Aufgabe als LINKE Gemeinsamkeiten zwischen sozialen Wirklichkeiten und Identitäten aufzuzeigen.
Was jenseits der Milieudebatte allerdings zutrifft (übrigens auch in vielen anderen Ländern Europas und Lateinamerikas) ist die Beobachtung, dass die Linke gerade Menschen in den prekärsten Lebenslagen immer schlechter erreicht. Das hat u.a. damit zu tun, dass der Neoliberalismus mit der Prekarisierung der Beschäftigung und seiner gnadenlosen Wettbewerbsideologie den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zerstört hat. Gerade in den ärmsten Teilen der Bevölkerung ist eine rasante Entpolitisierung zu beobachten, gibt es kaum noch Hoffnung, die Lebensverhältnisse politisch verändern zu können.
Diesem Problem muss sich die LINKE stellen! Doch das geschieht eben nicht durch eine ausgrenzende Milieudebatte, sondern durch eine positiv bestimmte politische Arbeit: Wenn die LINKE wieder in Betrieben und ärmeren Stadtteilen Fuß fassen will, muss sie Arbeitskämpfe wie aktuell die Krankenhausstreiks unterstützen, Mieter*innen wie bei den Volksbegehren zur Kommunalisierung von Wohnraum organisieren oder Sozialberatung für Betroffene anbieten, wie dies in vielen Abgeordnetenbüros der LINKEN ja auch schon lange geschieht.
Gefragt sind hier keine Talkshow-Bekenntnisse, sondern echte Empathie, gesellschaftliche Verankerung und Basisarbeit!
8/ Keine individuelle Profilierung auf Kosten der Partei. Ebenfalls schwer geschadet hat uns das Verhalten prominenter Mandatsträger*innen, sich gegen und auf Kosten der Parteilinie zu profilieren. Hier benötigen wir eine innerparteiliche Kultur und auch Mechanismen, um solche Praktiken zu stoppen. Wie diese Mechanismen konkret aussehen können, ist für uns eine offene Frage. Fest steht für uns jedoch: Es muss sich etwas ändern.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Selbstverständlich haben auch Abgeordnete das Recht, mit demokratisch getroffenen Mehrheitsentscheidungen unzufrieden zu sein. Doch hier sollte der Grundsatz gelten, dass politische Kontroversen und Debatten in den dafür vorgesehenen Gremien und Diskussionsformaten ausgetragen werden.
Mandatsträger*innen jedoch haben die Aufgabe, die nach Debatten gefassten Entscheidungen und Positionen in ihren öffentlichen Funktionen auch zu vertreten. Immerhin haben sie ihre Mandate vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sie von der Partei nominiert wurden und im Wahlkampf durch die Aktivität vieler unserer Mitglieder unterstützt wurden. Sie sind Vertreter*innen der Partei – nicht freischwebende Individuen – in Parlamenten oder anderen Körperschaften. Wer Mandatsträger*in der LINKEN ist, muss sich bemühen, den Parteikonsens sichtbar zu machen. So viel kollektiven Verantwortungssinn sollten wir auch in einer offenen, pluralistischen Partei voneinander erwarten können.