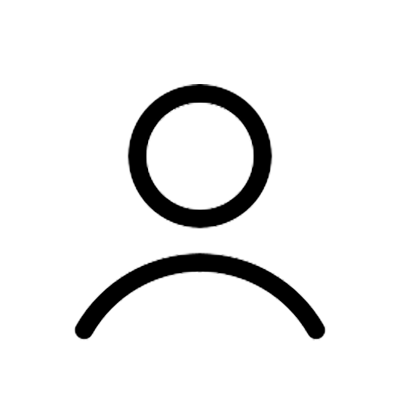Männliche Macht der Sprache
Nachdem das Justizministerium vergangenen Monat einen Gesetzesentwurf zum Insolvenzrecht vorgelegt hatte, hagelte es maßregelnd-konservative Kritik. Nicht wegen des Inhalts, aber wegen der Form: Der Text war - wie ein Sprecher erklärte, aus anwendungspragmatischen Gründen - im generischen Femininum verfasst.
Das Innenministerium zweifelte an der Verfassungskonformität der Vorlage, obwohl die generische - also für alle Geschlechter geltende - Qualität des grammatischen Femininums definiert war. Ebenso wie es beim generisch maskulinen Äquivalent anerkannt ist. Der CDU-Wirtschaftsrat nannte die Grammatikalität des Textes eine „Spielerei“, ein Rechtspolitiker der AfD kommentierte ihn mit den Begriffen „lächerlich“ und „unwürdig“ und auch der Verein Deutsche Sprache empfand das sprachliche Vorgehen des Justizministeriums als „Versagen“.
Dass konservative und rechte Köpfe dem progressiven Anliegen geschlechtersensitiver Sprache nicht zugeneigt sind und sich auf herkömmliche Regelungen berufen, überrascht nicht. Dieser Reflex der Selbsterhaltung ist innerhalb einer patriarchal-traditionalistischen Logik folgerichtig. Aber die Zeit dieses Denkens ist vorüber.
Bereits 1791 hatte die französische Revolutionärin und Schriftstellerin Olympe de Gouges das reale Auseinanderdriften des generisch Anmutenden aber spezifisch Umgesetzten demonstriert: Analog zu der frisch verfassten Menschen- und Bürgerrechten der Revolution formulierte sie die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. De Gouges landete damals für ihre feministischen Aktivitäten auf dem Schafott.
Nun ist das Guillotinieren politischer Gegner*innen in Europa (Teil der) Geschichte. Das explizite Ausschließen von Frauen (oder anderen Menschen nicht cismännlichen Geschlechts) lässt sich heute vor dem Hintergrund des Artikels 3 des Grundgesetzes nicht mehr offen erklären. Aber zumindest das durch das generische Maskulinum dargestellte Mitmeinen, hat seine bewusst gesetzten Grenzen. Anderenfalls würde ab Mitte-Rechts nicht so vehement gegen Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter geschossen.
Wieder eine Gelegenheit das Vertrauen einiger Parlamentarier*innen in die Verfassung dieser Demokratie kritisch zu betrachten. Immerhin befürchtete das Innenministerium, dass das vorgebrachte Gesetz als eines ausgelegt werden könne, das nur für Frauen angewendet würde und somit verfassungswidrig sei. Den Hinweis auf die generische Aussage des Femininums im Gesetzesentwurf hielt man sich unterdessen mit dem Argument der fehlenden sprachwissenschaftlichen Anerkennung vom Leib.
Hier zeigt sich der Zirkelschluss. Es ist kein Geheimnis, dass die feministische Linguistik seit bald einem halben Jahrhundert ergebnisreich zugunsten der Geschlechtergerechtigkeit forscht und hierin in aller Deutlichkeit für die Abschaffung des generischen Maskulinums als patriarchaler Stütze argumentiert und dennoch immer wieder vom konservativen Lager der Akademia massiv ausgebremst und diskreditiert wird.
Eine wegbereitende politische Entscheidung für eine geschlechtersensible Sprache, wie sie sich abseits des nach wie vor männlich regulierten Kanons ohnehin in vielen medialen und alltagssprachlichen Sphären durchsetzt, würde auch das Argument der Ökonomie aushebeln, das in Bezug auf personale Doppelnennungen, die Verwendung des Unterstrichs oder des Gender-Sternchens angeführt wird: Es dauere zu lange, mehr als das generisch Männliche zu nennen.
Zwar blieben die gendergerechten Bezeichnungen so lang, wie sie eben sind. Aber das Ende der Diskussionen darum, würde im Dienste der eigentlichen Inhalte einiges an Zeitersparnis mit sich bringen.
Das Justizministerium hat den Gesetzesentwurf unterdessen zurückgezogen und eine generisch maskulin formulierte Variante vorgelegt, um der aktuellen Dringlichkeit beizukommen, schließlich seien viele Unternehmen in der pandemischen Zeit von Insolvenz bedroht. Der sozialdemokratische Glauben an gesellschaftliches Vorankommen in Hinblick auf die Bedeutsamkeit sprachlicher Formen von Repräsentation, beugt sich hier also dem Argument der Zeitökonomie und verkennt die Signalwirkung einer konsequenten Haltung.
Ein weiterer Staffelstab, der aus den Parlamenten heraus wieder in die Bewegung zurückgereicht wird, um der patriarchalen Kruste dieser Gesellschaft ihre Überholtheit vor Augen zu führen.